Hochseilgaloppierend
Quatuor Modigliani und Sharon Kam spielen Schubert und Brahms
Wenn die Tücken der Programmplanung zum Aberwitz werden: Am Donnerstagabend spielen drei hervorragende Streichquartette gleichzeitig. Selbst in Berlin ist das kein Normalfall. Und schon gar nicht, dass zwei davon (Belcea im Boulezsaal und Modigliani im Kammermusiksaal) Schuberts Der Tod und das Mädchen spielen. Drittes Angebot in der Terminkollision wäre das Pavel Haas Quartett, das im Konzerthaus im Rahmen der Schostakowitsch-Hommage auftritt. Ich entscheide mich am Ende für die Modiglianis: weil ich die noch nie gehört habe und weil dort auch noch die israelische Klarinettistin Sharon Kam dabei ist. Und Brahms.
WeiterlesenFrühstherblingshaft
Antoine Tamestit und Alexander Melnikov spielen Brahms und Schostakowitsch im Konzerthaus
Wochenbeginn-Spätbrahms und Montags-Endzeitschostakowitsch: gerade das Richtige zum Frühlingsanfang. Der Bratscher Tamestit und der Pianist Melnikov spielen im Kleinen Saal des Konzerthauses, im Rahmen einer zweiwöchigen Hommage an Dmitri Schostakowitsch, die gerade diffuse Gefühle hervorruft und diffuse Reaktionen auslöst: etwa einen aufreizend wischiwaschi formulierten Einlegezettel von Chefdirigent Eschenbach und Intendant Nordmann, der die konkrete Verantwortung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausklammert (stattdessen Schicksalssätze wie „das Undenkbare ist geschehen“). Oder die seltsame Idee von Dirigent Krzysztof Urbański, am Freitag statt der Leningrad-Sinfonie Schostakowitschs Fünfte zu spielen, die ja ein nicht minder ambivalentes Werk ist. Wäre es nicht sinnvoller, klar auszusprechen: „Putin ist ein Mörder und Kriegsverbrecher“; und dennoch die Leningrad-Sinfonie zu spielen, die immerhin weder von Putin noch von Stalin komponiert wurde?
Anyway, das Programm des Rezitals von Tamestit und Melnikov ist unabhängig von allen aktuellen Weltläuften in sich stimmig.
WeiterlesenEntnachtend
Klavierfreuden in Mendelssohn-Remise und Pianosalon Christophori, John Eliot Gardiner bei den Philharmonikern
Die kleinen Musikorte erholen sich – wie die freien Musiker – mühsamer von der langen Nacht der (wohl noch nicht beendeten) Pandemie, als es große Institutionen und begehrte Stars tun. Eine kleine Klavierrunde führte mich in der vergangenen Woche nordwärts in den Wedding, wo im Pianosalon Christophori an zwei Abenden die jungen Musiker Andrei Gologan und Florian Heinisch spielten, und tags zuvor in die feine Mendelssohn-Remise, unweit vom Gendarmenmarkt. Dort eröffnete gleichzeitig die große Elisabeth Leonskaja eine Schostakowitsch-Hommage, den lang geplanten und nun von kriegerischen Zeitläuften an den Rand des Heiklen geführten Programmschwerpunkt des Konzerthauses. Auf der breiten Freitreppe stimmt dort eine Menschenmenge gutgemeint, aber schwer erträglich ein von beschwingtem Moderator animiertes Lied für den Frieden an.
Weiterlesen„Vielleicht hat man gar nicht ein wahres Wesen, sondern …“
… viele verschiedene. Hinweis auf meine Nebentätigkeit als Romanautor: Vor einigen Tagen ist mein neues Buch erschienen. Es heißt Luyánta – Das Jahr in der Unselben Welt. Wie alle meine bisherigen Romane beim Rowohltverlag. Nur dass dieser hier viel länger ist und auch (aber keinesfalls: nur!) für Jugendliche geschrieben ist. Er handelt von einem Mädchen, das einen Drachen in sich trägt, ganz unausstehlich sein kann und doch voller Kraft und voller Liebe ist. Sie trägt mindestens zwei Namen, ist Teenager und Königin und weißes Murmeltier, und sie muss um Frieden kämpfen – in der Unselben Welt und in sich selbst. Sagen wir, wie’s ist: ein Schmöker. In jeder Buchhandlung und natürlich auch online erhältlich.
Weitere Informationen beim Rowohlt Verlag
Ach ja, und ein Hörbuch gibt’s auch: über 24 Stunden, gelesen zu meiner großen Freude von der phantastischen Schauspielerin Constanze Becker.
Und für die erste öffentliche Lesung am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr im Berliner Pfefferberg gibt’s auch noch Karten!
Wiegemarschtanzend
Pablo Heras-Casado und das RSB spielen Debussy, de Falla, Bartók
Drei auf je eigene Weise tänzerischen Musiken stellt der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin kurzentschlossen die Berceuse héroïque voran, die Claude Debussy 1914 nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges komponierte: antrisches Wiegenlied, großes Crescendo und Generalpause, dann Trauermarsch. Ein eigenartiges Werk mit paradoxem Titel, aber der aktuellen Situation angemessen als Ausdruck eines gewissen Ratlosigkeit, des gleichzeitigen Drangs zum Sprechen und zum Verstummen. Und eine Ergänzung zu Vladimir Jurowskis Aufführung der ukrainischen Nationalhymne vor zehn Tagen. Dazu passt, dass Heras-Casado nicht viele Worte sagt wie Jurowski (sehr kluge, menschliche Worte), sondern nur: „Wir spielen das im Gedenken an die Ukraine.“ Beide Arten des Umgangs – die introvertierte wie die demonstrative – haben ihre Berechtigung.
WeiterlesenTrismegistisch
Collegium 1704, Les Arts Florissants und Jean Rondeau beim Barock-Festival in der Philharmonie
Drei sehr verschiedene Konzerte am zweiten (und letzten) Wochenende des Barock-Festivals, jedes auf seine Weise beeindruckend: trimagisch, ja geradezu trismegistisch. Den Anfang macht am Freitagabend das tschechische Collegium 1704 im Kammermusiksaal. Auf dem Programm steht unter anderem ein Bachkonzert (BWV 1060, c-Moll) mit den Solo-Instrumenten Oboe und Violine, während gleichzeitig die Berliner Philharmoniker im Großen Saal ebenfalls ein Bachkonzert mit Oboe spielen (BWV 1055R). Kuriose Selbstkannibalisierung. Das Barock-Festival ist ja eine Veranstaltung der Stiftung Berliner Philharmoniker, die Reihe „Originalklang“ in gebündelter Form, und das Collegium 1704 geladener Gast der Hausherr/*/frauschaft. Ohne dem Orchester, Dirigent Roth und vor allem Albrecht Mayer nahezutreten, den aufregenderen, quickigeren Bach gibt’s ziemlich gewiss bei den tschechischen Spezialisten.
WeiterlesenUkrainisch-umarmend
rsb, Jurowski, Alban Gerhardt spielen Werbyzkyj, Rubinstein, Smirnow und Tschaikowsky
Bei Vladimir Jurowski wird aus einem klaren politischen Statement gleich eine musikalische Weiterbohrung: Denn auf die ukrainische Nationalhymne, mit der nach spontaner Programmänderung das Konzert in der Philharmonie beginnt, spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin noch ein weiteres Werk ihres Komponisten Mychajlo Werbyzkyj, die gut gearbeitete Sinfonische Ouvertüre D-Dur, schmissig wie ein Stück von Suppé. Vor allem aber ergeben sich atemberaubende, in der Mitte geradezu verstörende Bezüge zum planmäßigen Rest des Programms, auf dem drei höchst unterschiedliche Werke russischer Komponisten stehen.
WeiterlesenDeconquista!
Accademia del Piacere beim Barock-Festival in der Philharmonie
Auf welcher Insel der Seligen man lebt, wird einem bewusst, wenn man in der Berliner Philharmonie entzückt beim Barock-Festival sitzt, während gerade ein demokratisches Land von den Panzern eines gewissenlosen Großmachtpsychopathen überrollt wird. Die Ukraine liegt näher an Berlin als Spanien, Kiew näher als Madrid oder gar Sevilla, wo die Accademia del Piacere ihren Sitz hat. Deren Zugabe im Kammermusiksaal widmet der Leiter Fahmi Alqhai der Kraft des Friedens; so wie die Berliner Philharmoniker nebenan im Großen Haus ihr Mahler-Konzert mit Gustavo Dudamel den Menschen in der Ukraine zueignen.
Hier also nur einige inselselige Notizen zum köstlichen Konzert der Accademia del Piacere. Spanische Tänze und Melodien aus dem 16. und 17. Jahrhundert, in aufregender, aber nicht anbiedernder Verzeitgemäßung. Notierte Quellen sind offene Grundlage der Musik, nicht fertige Vorgabe. Nach zwei gediegenen, fast schulbuchmäßigen tänzerischen Nummern beginnt es schlagartig zu lodern: Über stehendem Bordunton setzt ein improvisatorisches Gambensolo von Fahmi Alqhai ein, immer wieder ins Mikrotonale pendelnd, rhythmisch sehr frei gefärbt vom Percussionisten Agustín Diassera.
WeiterlesenMiese beflügelnd!
Ton Koopman beim Konzerthausorchester
So miese kann’s einem gar nicht gehen, dass einem durch Carl Philipp Emanuel Bach nicht neuer Esprit injiziert würde. Und durch die beflügelnd vitale Erscheinung von Ton Koopman, dem schon 77jährigen niederländischen Cembal- und Organisten und auch Dirigenten, der beim Konzerthausorchester unter anderem zwei CPE-Sinfonien aus der späten Hamburger Zeit im Programm hat. Die bekanntere ist die in D-Dur (Wq 183/1), eine der originellsten, überraschungsbombigsten überhaupt. Und auch wenn man sich in den Abschnittsbeginnen des ersten Satzes die Kontraste noch unverschämter geschärft vorstellen könnte, flutschen doch die Streicher famos und die Holzfarben leuchten mit schöner Kontur.
WeiterlesenHerabsphärend
Benedikt Kristjánsson und Margret Köll im Pierre-Boulez-Saal
Gegen die Barockharfe, die in diesem Konzert gleich in mehreren Formen zu erleben ist, wirkt das moderne Konzertgoldflügelgetüm wie ein monströser SUV im Vergleich zu einem wendig-schnittigen Fahrrad. Über mehr als 4000 Jahre leitet Michael Horst in seiner Einleitung die Bedeutung des Instruments und der dazugehörigen Stimme her, bis zu den Pyramiden und natürlich zum Orpheus-Mythos. Vor einigen Wochen hat die Komische Oper einen lohnenden neuen Orfeo vorgestellt: den geradezu simplen von Gluck. Die Lieder von Emilio de‘ Cavalieri und Giulio Caccini, mit denen der Tenor Benedikt Kristjánsson und die Barockharfenistin Margret Köll ihr Programm im Boulezsaal beginnen, erinnern allerdings eher an eine andere, frühere Orphik, nämlich die von Maestro Monteverdi.
WeiterlesenKältebarmend
Premiere „Die Sache Makropulos“ von Leoš Janáček an der Staatsoper Unter den Linden
Was für eine Vision: als altgewordener Mann die Geliebte von vor fünfzig Jahren wiederzutreffen, und sie ist genauso jung wie damals, während man selbst am Abend seines Lebens steht. So ergeht es einer Nebenfigur namens Hauk-Šendorf in Leoš Janáčeks „Sache Makropulos“: Tenorbuffo, was die Schwerstmut der Angelegenheit ins Ulkig-Bizarre dreht, dazu spanische Rhythmen, Kastagnetten etc pp. Denn die Geliebte hieß Eugenia Montez, damals war’s, in Spanien … Aber wie fühlt sich das aus der anderen Perspektive an – aus Sicht der Ewigjungen, die den gealterten Liebhaber wiedertreffen muss?
Eine der vielen faszinierenden aus mehreren Perspektiven faszinierenden Situationen in dieser Oper, die einen zuverlässig überwältigt, auch wenn man die Handlungsfeinheiten erst nach der circa dreißigsten Vorstellung kapiert. Denn der Auslöser, ein verzwickter juristischer Erbschafts-Kasus, ist schwer zu durchblicken. Die zugrundeliegende, offenbar eher mittelmäßige Theatersatire von Karel Čapek (dem Schriftsteller, der das Wort „Roboter“ erfand) färbte Janáček in ein sondergleichen existenzielles Drama um, ein genialisches Missverständnis, über das Čapek verwundert den Kopf schüttelte. Die Komik ist aber zum Teil geblieben: Hauk-Šendorf etwa will sofort die Juwelen seiner Ehefrau versetzen, die so alt ist wie er, um mit der aspikierten E.M. durchzubrennen, als könnte er so vor dem Tod davonlaufen.
WeiterlesenRappelruhigend
Musik von und mit Konstantia Gourzi im Boulezsaal
Aus einer „Vibration der Stille“ entstehe die Musik von Konstantia Gourzi, erklärt der Pianist William Youn. Gemeinsam mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer geben die beiden im Pierre-Boulez-Saal ein leises, konzentriertes und doch abwechslungsreiches Konzert, von dem man – klänge es nicht so kitschig – sagen möchte, dass es dem Hörenden tiefe, doch schillernde Ruhe schenkt.
Fein durchgearbeitet sind die vielen kleinen Teile der größeren Einheiten, die sich dem Wind oder dem Blick aus dem Fenster widmen, den Bienen und Bäumen, der Liebe und dem Meer. Dass sich hinter einer bestimmten Komposition etwa die Erinnerung an Chagall-Bilder versteckt, kann man wissen, muss es aber nicht. Denn die Musik lässt sich unmittelbar erfahren. In Klavierstücken tritt der einzelne Ton spannungsvoll hervor, und zum Ereignis wird es, wenn er mit einem zweiten Ton verschmilzt oder mit Tropfen und Klopfen. Oder das Geschehnis eines Crescendo. wind whispers wäre die Musik, die der Film Nomadland gebraucht hätte, dessen Großartigkeit durch den Einaudi-Soundtrack zu ruinieren drohte (denn mit der Banalität Einaudis hat Gourzis zum Klingen gebrachte Stillevibration nichts zu tun).
WeiterlesenKramsreif
Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, András Schiff spielen Brahms und Josef Suk
Kirill Petrenko setzt bei den Philharmonikern seine Reihe Brahms plus Krams fort. Wobei mich vor allem der Krams reizt. Aber dem vorhergehenden 2. Klavierkonzert von Brahms mit András Schiff (ein Repertoire-Programmpunkt, der narrensicher für volles Haus auch für die folgende Ultra-Rarität sorgt) kann ich mehr abgewinnen als der zweiten Sinfonie im Januar, die mich nicht vollends überzeugte. Schiff ist hier natürlich eine Bank, auch wenn er so viel mehr gelehrt als instinktiv klingt. Vor kurzem brachte er eine der interessantesten Einspielungen der beiden Brahmskonzerte heraus, die es gibt, auf einem Blüthner gespielt.
WeiterlesenRobbenpistolig
Hinreißender Liederabend mit Golda Schultz und Jonathan Ware im Boulezsaal
Was der Pierre-Boulez-Saal diese Woche an ausgefallenen (im Sinn von raren, nicht etwa von abgesagten) Programmen bietet, ist bemerkenswert: Den einen Tag spielen der Pianist Melnikov & Co an Hindemith-Sonaten, was niemals gespielt wird. Am Samstagabend wird ein hochbesetztes Trio um die Komponistin Konstantia Gourzi nichts als Musik von Gourzi aufführen. Und dazwischen präsentiert die südafrikanische Sängerin Golda Schultz mit ihrem Klavierbegleiter Jonathan Ware ausschließlich von Frauen komponierte Lieder aus zweihundert Jahren; das Ganze zusätzlich auch als „Elternzeit-Konzert“ für Babys ab 0 Monaten, auf dass in Zukunft niemand mehr behaupten möge, er habe gar nicht gewusst, dass „auch Frauen komponiert haben“. Und wie gut Golda Schultz ist, Weltstar in spe.
Weiterlesen
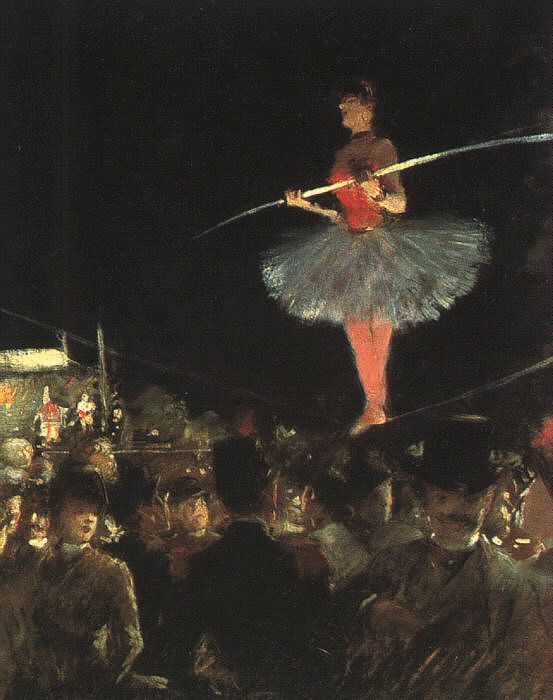


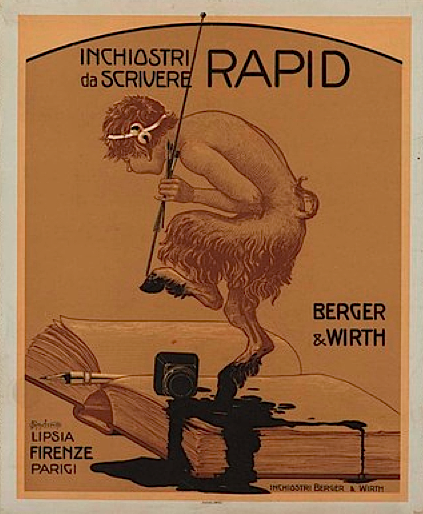





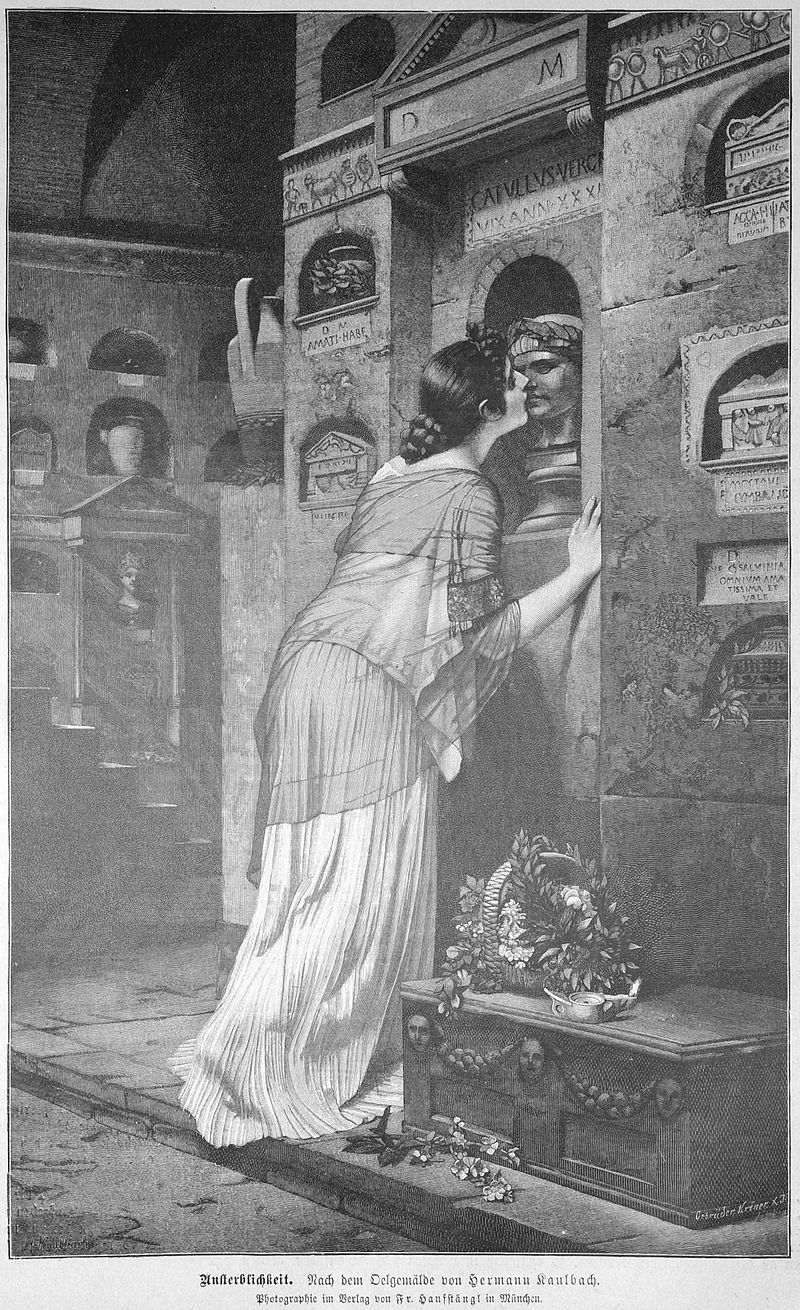



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.