Nach der Walküre kommt … Das Rheingold. Zumindest in diesen Zeiten, in denen die Pandemie Dramaturgien verwirbelt, als hätte Godard seine Finger im Spiel. Zu meiner eigenen Überraschung hat mir das kunterbunte Vorspiel der frei flottierenden Assoziationen besser gefallen als der vermurkste erste Tag. Ausführlich kann man meine Eindrücke im neuen VAN Magazin nachlesen.
Schlagwort-Archive: Donald Runnicles
Nächtliche Notiz zur neuen „Walküre“ an der Deutschen Oper
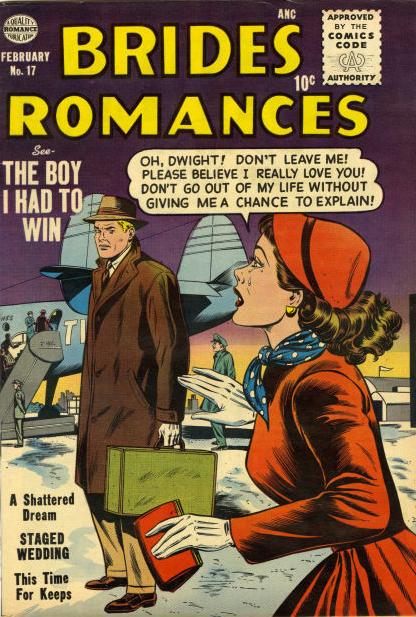
Startschuss zum neuen RING DES NIBELUNGEN-Zyklus an der Deutschen Oper Berlin, pandemieausfallbedingt mit der WALKÜRE. Dass der Rheingold-Vorabend fehlt, dürfte aber nicht das Hauptproblem für Stefan Herheims Inszenierung sein. Eher, dass man ihr variiertes Einheitsbühnenbild (zahllose Koffer sowie ein Konzertflügel und große Wackeltücher) schon nach dem zweiten Akt einigermaßen über hat. Wie soll denn das bis zur GÖTTERDÄMMERUNG tragen? Auch an sich nicht uninteressante Kopfgeburten wie ein Gollum-artiges Söhnchen für Sieglinde und Hunding richten mehr zerfasernden Nervschaden als gegenlichtige Erkenntnis an. Aber wer weiß, was noch kommen wird. Und das Orchester klingt ziemlich gut. Und Lise Davidsen dürfte die stimmmächtigste Sieglinde aller Zeiten sein. Und Nina Stemme als Brünnhilde, ah, La Stemme: Die macht alles groß. Auch das zu klein Gedachte.
Jetzt erstmal schlafen und morgen frisch nochmal drüber nachdenken. Am Mittwoch erscheint dann mein ausführlicher Artikel über die neue WALKÜRE im VAN Magazin.
Düstrentagshoffend: „Rheingold auf dem Parkdeck“ der Deutschen Oper

Wagner-Wahnsinn kündigt ein Plakat an der Beton-Mauer des Parkhauses hinter der Deutschen Oper Berlin immer noch an, und um die Ecke wird Entdeckerkurs verheißen. Um Rued Langgaards raren Antikrist aus den 1920er Jahren, der im März ohne Corona hier Premiere gefeiert hätte, kanns einem besonders leidtun. Und auch auf das neue Rheingold, das es als Höhepunkt der Wagner-Wochen und Beginn des neuen Ring-Zyklus im Juni hätte geben sollen, war man gespannt. Eine eingeschmolzene Fassung also nun. Unter strikten Bedingungen im Parkhaus der Oper – eher Lebenszeichen als Geniestreich, aber ein wohltuendes, für manche sogar lebensnotwendiges.
WeiterlesenMittsommerspartanisch: Benjamin Brittens A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM an der Deutschen Oper
Die Feenwelt ist ganz schön gruselig. Und der Wald bei Athen, wo Benjamin Brittens A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM nach Shakespeare spielen soll, arg spartanisch. Zumindest in der Inszenierung von Ted Huffman, die jetzt an der Deutschen Oper Berlin Premiere hatte.

Rundum beglückend: Leoš Janáčeks „Jenůfa“ an der Deutschen Oper
Was soll man am heftigsten lieben, was ist das größte Glück an dieser Jenůfa von Leoš Janáček, die jetzt an der Deutschen Oper Berlin wiederaufgenommen wurde?
WeiterlesenGraboffen: TRISTAN UND ISOLDE an der Deutschen Oper
Lachendes Löschen von Leuchte und Lebens Licht statt Adventskerzlein-Anzünden. Zum meteorologischen Winteranfang, Welt-AIDS-Tag und Jour des Heiligen Eligius, der widerspenstigen Pferden die Füße ausriss und fertig beschlagen wieder anheilte, nimmt die Deutsche Oper Berlin Richard Wagners TRISTAN UND ISOLDE wieder auf, in der ziemlich kontroversen Inszenierung von Graham Vick, die für Regieverächter auch ein dramaturgisches Raufen, Rupfen und Zupfen von Extremitäten ist, für den Konzertgänger jedoch – ja, fast ein Wunder.
WeiterlesenLiebesverwunderlich: Detlev Glanerts OCEANE an der Deutschen Oper
Juhu, endlich mal wieder eine Berliner Opern-Uraufführung mit Pause sowie unverquaster Sprache! Letzteres dank Theodor Fontane, der eine zwölfseitige Skizze über eine Wasserfee hinterließ, die unter die Menschen gerät, und dank Hans-Ulrich Treichel, der daraus ein Libretto gezimmert hat, das er Sommerstück nennt. Und die Musik des Komponisten Detlev Glanert in der am Sonntag an der Deutschen Oper uraufgeführten OCEANE kann man auch prima anhören.
WeiterlesenArg: Zemlinskys „Zwerg“ an der Deutschen Oper
Himmelhochjauchzen à la berlinaise: nichts zu meckern heute. Wahrscheinlich ist das sogar die beste, rundeste Premiere der Saison an der Deutschen Oper. Besetzung hervorragend, Orchester gut in Schuss, Inszenierung schlüssig. Und das Werk, DER ZWERG von Alexander Zemlinsky, eine arge Angelegenheit im besten Sinn.
Und das, obwohl Tobias Kratzers Regie der Sache über die biografische Schiene kommt. Da könnte man an sich zweierlei fragen: Erstens allgemein, was einen das heute noch anginge, dass Zemlinsky nur einssechsundfuffzig war und eine Frau ihn mal hässlich fand. Zweitens konkret, ob die inszenierten Auftritte von Komponisten in ihren Opern nicht abgenudelt sind. Der arge Hallodri Wagner in Koskys Bayreuther Meistersingern blieb zuletzt in bestürzender Erinnerung – ebenfalls im besten, d.h. schlimmen Sinn.
WeiterlesenDernieren (1): Berlioz‘ „La Damnation de Faust“ an der Deutschen Oper
 Zum letzten Mal! Alle Welt spricht von Premieren – aber wer nimmt sich der Dernieren an? Was war, was wir vermissen werden und was nicht: der Konzertgänger als Opernnachrufer. Den Anfang macht Christian Spucks Inszenierung von Hector Berlioz‘ „La Damnation de Faust“, die Samstag an der Deutschen Oper Berlin zum verdammt allerletzten Mal gegeben wurde.
Zum letzten Mal! Alle Welt spricht von Premieren – aber wer nimmt sich der Dernieren an? Was war, was wir vermissen werden und was nicht: der Konzertgänger als Opernnachrufer. Den Anfang macht Christian Spucks Inszenierung von Hector Berlioz‘ „La Damnation de Faust“, die Samstag an der Deutschen Oper Berlin zum verdammt allerletzten Mal gegeben wurde.
Im nicht gerade überfüllten Opernhaus herrscht an einem solchen Tag eine wundersame Atmosphäre, die an einen Badeort nach Ende der Saison erinnert. Weiterlesen
Bohnenbreiig: Alban Bergs „Wozzeck“ an der Deutschen Oper
Ach Gott, was wurde in wenigen Jahren aus dem hehren Wörtchen ewig! Ein Beben machendes neunmaliges Schlussmantra war dieses ewig in Mahlers Lied von der Erde. Im Wozzeck aber ist es nur noch ein Hohn, die hohe Tenorquetschvokabel des Hauptmanns im ersten Akt. Ein Weltkrieg und eine musikalische Revolution lagen dazwischen. Alban Bergs Wozzeck, 1921 fertiggestellt und 1925 uraufgeführt, gibts nun in einer neuen Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin. Musikalisch scheints eine recht runde Sache, fein geschält, inszenatorisch eher ein bunter Bohnenbrei. Weiterlesen
Sargzielig: „Tristan und Isolde“ an der Deutschen Oper
 Hart am Ziel, wie Isolde im ersten Aufzug singt, scheint auch diese Tristan und Isolde-Produktion der Deutschen Oper Berlin, die nach zwei Aufführungen am 3. Oktober zum letzten Mal in dieser Spielzeit gegeben wird. Ob sie danach ganz eingesargt wird, ist ungewiss, aber ein langes Leben dürfte ihr angesichts der rapide sinkenden Publikumsnachfrage nicht mehr vergönnt sein. Einen Tristan mit halbleerem Saal kann sich so ein Haus auf Dauer nicht leisten. Aber für den Konzertgänger, er sagts immer wieder, ist diese Arbeit von Graham Vick eine der schönsten und berührendsten Tristan-Inszenierungen, die er kennt. Weiterlesen
Hart am Ziel, wie Isolde im ersten Aufzug singt, scheint auch diese Tristan und Isolde-Produktion der Deutschen Oper Berlin, die nach zwei Aufführungen am 3. Oktober zum letzten Mal in dieser Spielzeit gegeben wird. Ob sie danach ganz eingesargt wird, ist ungewiss, aber ein langes Leben dürfte ihr angesichts der rapide sinkenden Publikumsnachfrage nicht mehr vergönnt sein. Einen Tristan mit halbleerem Saal kann sich so ein Haus auf Dauer nicht leisten. Aber für den Konzertgänger, er sagts immer wieder, ist diese Arbeit von Graham Vick eine der schönsten und berührendsten Tristan-Inszenierungen, die er kennt. Weiterlesen
Musikfest 2018: Deutsche Oper zimmermannt
Zur Kugelgestalt wird hier die Zeit. Eins der apartesten Zusammentreffen beim Musikfest bietet das Orchester der Deutschen Oper unter Donald Runnicles in der Philharmonie: Richard Wagner meets Bernd Alois Zimmermann. Letzterer einer von mehreren Schwerpunkten im diesjährigen Programm. Während die wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Sinfonie in einem Satz, die die Rotterdamer am Sonntag spielten, ihren panischen Ausdruck geradezu herausschrie, stehen an diesem Mittwoch zwei der stilistisch gefinkelteren letzten Werke auf dem Programm: das kurz vor Zimmermanns Selbsttötung 1970 entstandene Stille und Umkehr und davor Photoptosis von 1968. Ein schwer erschütterndes Doppel ist das.
Fishy: Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ an der Deutschen Oper
 Letzte Gelegenheit, in verkommener Gesellschaft im Trüben zu fischen: Am kommenden Freitag gibts den allerletzten fischblutfleischroten Vorhang für Ole Anders Tandbergs Inszenierung von Dmitri Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk an der Deutschen Oper Berlin. Beim vorletzten Vorhang, erst der siebten Aufführung seit der Premiere 2015, war der Konzertgänger dabei. Aus Herzensneigung zur armen Lady Macbeth alias Katerina Lwowna, dieser kämpferischen Schwester der Katja Kabanowa, deren Mordbereitschaft sie am Ende doch auch nur ins Wasser führt (Handlung). Weiterlesen
Letzte Gelegenheit, in verkommener Gesellschaft im Trüben zu fischen: Am kommenden Freitag gibts den allerletzten fischblutfleischroten Vorhang für Ole Anders Tandbergs Inszenierung von Dmitri Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk an der Deutschen Oper Berlin. Beim vorletzten Vorhang, erst der siebten Aufführung seit der Premiere 2015, war der Konzertgänger dabei. Aus Herzensneigung zur armen Lady Macbeth alias Katerina Lwowna, dieser kämpferischen Schwester der Katja Kabanowa, deren Mordbereitschaft sie am Ende doch auch nur ins Wasser führt (Handlung). Weiterlesen
Schattensichtbar: Aribert Reimanns „L’Invisible“ an der Deutschen Oper Berlin
 Der französische Titel lohnt allein schon deshalb, weil offen bleibt, ob er DER, DIE oder DAS UNSICHTBARE bedeutet. Aber das ist nur einer von vielen Gründen, warum Aribert Reimanns neue Oper L’Invisible, uraufgeführt am Sonntag an der Deutschen Oper Berlin, so sehr lohnt: Dringliche Empfehlung für alle, denen diese Kunstform am Herzen liegt!
Der französische Titel lohnt allein schon deshalb, weil offen bleibt, ob er DER, DIE oder DAS UNSICHTBARE bedeutet. Aber das ist nur einer von vielen Gründen, warum Aribert Reimanns neue Oper L’Invisible, uraufgeführt am Sonntag an der Deutschen Oper Berlin, so sehr lohnt: Dringliche Empfehlung für alle, denen diese Kunstform am Herzen liegt!
Das WER, WIE, WAS der Oper ist allerdings komplex. Aber nicht esoterisch, sondern hinreichend durchdringbar, um eine packende Opernerfahrung zu machen. Vorausgesetzt, man macht sich vorher ein klein wenig mit dem dreiteiligen Aufbau der Sache vertraut.
Schwarzgrünschwarz: Wagners „Fliegender Holländer“ an der Deutschen Oper
Kohlrabendüsterer neuer Holländer, der eigentlich Erik und Senta heißen müsste – sowohl was Sängerleistungen als auch was Regiekonzept angeht.








Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.