Wie dem Spinat sein Eisen-Image, so eilt dem Kanadier Marc-André Hamelin der Ruf voraus, der technisch beste Pianist der Welt zu sein. Das mag, im Gegensatz zum Spinat, auch nicht falsch sein, allein wen interessiert’s? Musik ist ja kein Leistungssport mit Platzierungsabsicht. Außerdem schwingt manchmal ein maliziöser Unterton mit, so als wäre ein Pianist mit hohem Technikgehalt kein Künstler, sondern eine Maschine.

Samuil Feinberg
In den Kammermusiksaal hat Hamelin, wie es scheint, kein Konzeptprogramm mitgebracht, sondern einen Haufen guter Musik – in dem sich dann allerdings doch interessante Querverbindungen erhören lassen. Der Saal ist nicht ganz ausverkauft, aber sehr gut besucht, auch Igor Levit ist da, mit rotem Schal in Block A links.
Connaisseurs sind selbstverständlich nicht wegen Beethoven oder Chopin gekommen, sondern wegen Samuil Feinberg (1890-1962).
Weiterlesen →





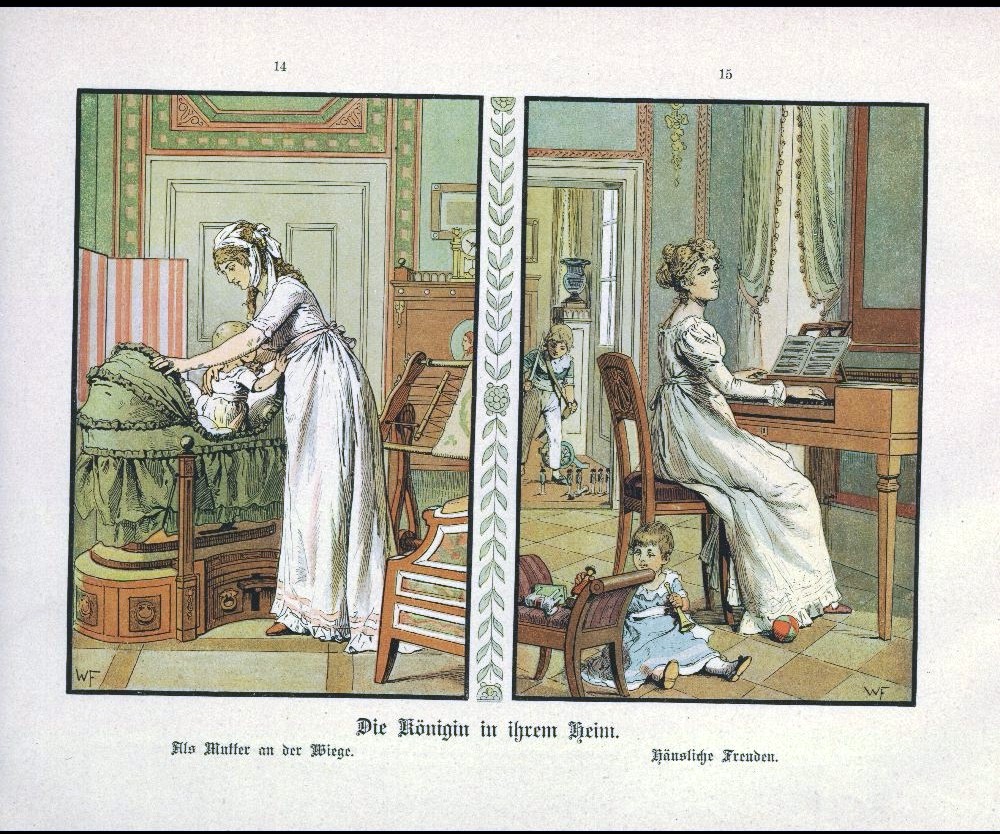

 Für den Konzertgänger immer ein Extrapunkt, wenn bei den Berliner Philharmonikern ein Komponist auf dem Programm steht, von dem er noch nie gehört hat. Das ist der Fall beim ersten Gastdirigat von
Für den Konzertgänger immer ein Extrapunkt, wenn bei den Berliner Philharmonikern ein Komponist auf dem Programm steht, von dem er noch nie gehört hat. Das ist der Fall beim ersten Gastdirigat von  Domenico Scarlatti fiele wahrscheinlich die Kinnlade auf den Jabot, wenn er im Konzerthaus säße und seine Nachbarin fragte, von wem denn diese hinreißenden Stücke seien, die der hagere junge Virtuose da spiele: Nocturnes, Fantasien, Etüden, unendlich nuanciert und durchgestuft in Klangfarben, Dynamik, Agogik und dabei ungeheuer dezent, von ferne an ein Cembalo erinnernd.
Domenico Scarlatti fiele wahrscheinlich die Kinnlade auf den Jabot, wenn er im Konzerthaus säße und seine Nachbarin fragte, von wem denn diese hinreißenden Stücke seien, die der hagere junge Virtuose da spiele: Nocturnes, Fantasien, Etüden, unendlich nuanciert und durchgestuft in Klangfarben, Dynamik, Agogik und dabei ungeheuer dezent, von ferne an ein Cembalo erinnernd.
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.