Bei diesem beklemmenden, befremdenden Filmdokument werden die Zeitfragen, welche das Festival MaerzMusik sich derart wortreich-allzu wortreich ins Thinking konzipiert hat, mal fürchterlich sinnfällig: Die Stadt ohne Juden, ein österreichischer Stummfilm von 1924 nach einem 1922 erschienenen Roman von übermorgen von Hugo Bettauer. Jahrzehnte verschollen gewesen, erst Anfang der 1990er Jahre in einem niederländischen Archiv und dann 2015 auf einem Pariser Flohmarkt wiedergefunden, mit Hilfe von 700 Privatpersonen per Crowdfunding vom Filmarchiv Austria restauriert, während in Europa die Flüchtlingskrise gärte und Politiker in Österreich und den USA Wahlen gegen Flüchtlinge gewannen. Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth hat eine ambitionierte, sinnliche, kluge und dennoch teils problematische Musik dazu geschrieben, die jetzt auch in Berlin aufgeführt wurde, im Haus der Berliner Festspiele.
WeiterlesenSchlagwort-Archive: MaerzMusik
Flatterig: Fure, Janulytė und Neuwirth bei MaerzMusik

Zu den prägenden Jugenderfahrungen der Frau des Konzertgängers zählt das tagelange mysteriöse Flattergeräusch über dem Badezimmer der Studentinnen-WG. Schließlich untersuchte ein männlicher Übernachtungsgast einmal den Lüftungsschacht und fand Blut und Federn einer verendeten Taube. – Ungefähr so klingt der Beginn von Ashley Fures Bound to the Bow, das ein Programm der aktuellen MaerzMusik mit drei Komponistinnen und dem Konzerthausorchester unter Peter Rundel eröffnet.
WeiterlesenZeitblubbernd: Eröffnung MaerzMusik mit Rzewski und Rădulescu
Nach der antiken Klepsydra ist eins der beiden Werke im Eröffnungskonzert der MaerzMusik benannt: einer der Sanduhr ähnlichen, nur eben feuchteren Wasseruhr. Das Plätschern und Blubbern von ablaufendem Wasser meint der Konzertgänger zu vernehmen, wenn er so durchs diesjährige Seminarprogramm des Festivals für klangbezogene Kunstformen (jede Menge Vorträge, Panels, Reading group etc.) und durch den Reader on Time Issues (Agamben, Diederichsen usf.) blättert. Einiges mag sich als aufschlussreich konkret herausstellen, etwa die „medienarchäologischen Zeitreisen“ der Tele-Visions. Dezente Schwerpunkte widmen sich z.B. den Komponistinnen Ashley Fure, Jennifer Walshe, Olga Neuwirth. Und die 30stündige Konzert-Exuberation The Long Now am nächsten Wochenende ist wieder Anker und Zielpunkt des Festivals.
Die Werke des ersten Abends im Haus der Berliner Festspiele sind wie klares Wasser – in einem dennoch strapazierenden Konzert, in dem der Durchlauf der Wasseruhr gelegentlich verstopft scheint.
Weiterlesen16.3.2017 – Entschwurbelnd: Eröffnung MaerzMusik mit Catherine Christer Hennix
Vergessen alles Geschwurbel, als die Musik beginnt. Genauer gesagt: als man merkt, dass sie längst begonnen hat. Denn zwei Arten von Geschwurbel stehen Wache am Tor zur MaerzMusik, dem ehemaligen Festival für neue Musik, das sich seit drei Jahren Festival für Zeitfragen nennt. Durch dieses schröckliche Tor muss am Donnerstag auch das Eröffnungskonzert im Weddinger silent green Kulturquartier, wo Catherine Christer Hennix‘ Minimalismus-Mysterium The Electric Harpsichord (1976, Neufassung 2017) im Zeichen des Nur erklingt.
16.3.2016 – Verwundernd: Max Richters SLEEP im Kraftwerk Berlin
Das Ende dieses achtstündigen Konzerts ist wie eine Auferstehung, es führt uns die allmorgendliche Neuerschaffung der Welt vor Augen und Ohren, ein Wunder, das wir im Trott unseres Dahinlebens vergessen. Obwohl der Komponist und Klassik-Charts-Stürmer Max Richter, wenn man ihn sprechen hört, eher ein nüchterner Typ zu sein scheint, kein Schwulstprediger oder gar Theorieklingler, kommt der Konzertgänger um diese pathetische Feststellung nicht herum. Während das Streichquintett seine repetitiven Akkordbrechungen scheinbar endlos wiederholt, die Sopranistin Grace Davidson in wortloser Oktaventranszendenz schwelgt, heben im riesigen Kraftwerk Berlin in über 400 Feldbetten die Erwachenden ihre Köpfe, einige stehen auf, gehen einer nach dem anderen auf Socken lautlos zur Bühne, zerzaust, aber selig: Der Schluss der Götterdämmerung ist nichts dagegen.

Es gibt Ideen, bei denen man sich fragt, weshalb noch niemand vorher darauf gekommen ist. Während man sonst im Konzert krampfhaft versucht, nicht einzuschlafen, um ja nicht 5 Minuten Bruckner-Ekstase zu verpassen oder den motivisch-thematischen Faden bei Brahms zu verlieren (obwohl Brahms selbst ein großer Konzertschläfer war), ist es bei SLEEP andersherum. Man muss zwar nicht schlafen (sleep or listen, as you like it, sagt Max Richter vorher, there are no rules), aber man kann, und die meisten tun es irgendwann. Nur die Musiker nicht, denn die Umsetzung einer genialen Idee besteht in harter Arbeit. Max Richter am Klavier und sein Ensemble (außer dem Streichquintett und der Sopranistin der Sound-Ingenieur Chris Ekers) musizieren von Mitternacht bis acht Uhr morgens ohne Unterbrechung, und das drei Nächte nacheinander. Am Morgen sitzen sie immer noch aufrecht, kein Strich verrutscht, keine Stimme bricht. (Wage noch einer zu behaupten, Künstler arbeiteten nicht!)
Drei Stunden vor Beginn ist Einlass, Bettennummern werden verteilt, auch Decken, obwohl die meisten ihr eigenes Bettzeug oder Schlafsäcke dabei haben, ein etwa 12jähriges Mädchen (das ihre Eltern mitgebracht hat) auch einen großen Stoffpanda. Im Erdgeschoss des Kraftwerks steht ein Catering-Laster, der Ratatouille und bemerkenswert gutes Bier feilbietet; widersinnigerweise auch die Wachhalteplörre Club-Mate. Manche Besucher gehen schon hoch und liegen ihre Betten warm, denn die weitläufigen Hallen sind trotz Heizstrahlern nicht gerade ein Siedekessel. Der Bettnachbar des Konzertgängers liest Thomas Hettches Pfaueninsel. Der Konzertgänger, Bett 175, der auch deshalb hier ist, weil er vor Jahren einen Fast-Weltbestseller über einen schlaflosen Wanderer veröffentlicht hat, erinnert sich an seine wilden Zeiten Anfang der 1990er Jahre im Bunker und Tresor, wo er sich sehnlichst andere Musik wünschte, aber mehr noch: ein Kopfkissen. Ein Königreich für ein Kopfkissen. Man sollte seine Wünsche nie vergessen, manchmal werden sie wahr. Und während er in der Philharmonie noch immer zu den Jüngeren gehört, ist er hier einer der Ältesten. Seine Kreditkarte hat er sicherheitshalber zuhause gelassen, bemerkt jedoch mit Schrecken, dass er keine Zahnbürste dabei hat, und fragt sich, ob all die schönen Frauen mit ihren Schlafmasken sich vor nächtlicher Antänzerei sicher fühlen. Aber es herrscht eine völlig unübergriffige Atmosphäre. Ein Mann mit langen Haaren tanzt entrückt durch die ganze Halle, wie die bärtige Cousine einer Sasha-Waltz-Tänzerin.
Man muss nur aufpassen, nicht schon vor Mitternacht einzuschlafen. Aber dann beginnt das Konzert: Max Richter spielt das Klavier so euphonisch wie er spricht, ein wohliger Bass begleitet die melancholisch heimeligen Akkorde. Helmut Lachenmann würde bei dieser Fülle des Wohllauts wahrscheinlich im Viereck springen. Aber auch wer Feldman und Adams für Gehirnwäsche oder euthanasierende Schmeichelei (Jean-Noël von der Weid) hält, wird gegen den sogenannten Minimalismus in dieser Rezeptionssituation keine Einwände erheben – falls er das zunehmende Hinlegen im Konzert nicht ohnehin als Indiz für die Verlümmelung der Gesellschaft im allgemeinen und des Musiklebens im besonderen und der MaerzMusik im ganz speziellen erachtet.
Die Musik ist dann doch lauter als man sie sich vorgestellt hat. Es lohnt aber sowieso, nicht gleich zu schlafen, sondern zwischendurch aufzustehen und durch die weiten Hallen des Kraftwerks zu wandeln. Überall hört man die sphärisch fließende Musik, man trifft einsame Toilettengänger und Teekocher. Keiner spricht. Auch wenn es etwas kindisch klingt, man kommt sich vor wie in einem Film oder Traum, einem Traumfilm.
Schließlich schläft man doch. Bis zur Auferstehung.
Dann ist es vorbei. Der Catering-Laster hat wieder geöffnet, zum Frühstück gibt es bayrisch-griechischen Honigjoghurt, die bärtige Cousine knabbert an einer Selleriestange. Beim Verlassen des Kraftwerks tritt man in überwältigenden Morgensonnenschein, anders, meint man, könnte es auch nicht sein nach einer solchen Nacht.
Max Richter / Zum Konzert / Zum Anfang des Blogs
15.3.2016 – Ins Offene wankend: Schuberts Winterreise mit Ian Bostridge und Julius Drake
Aus dem diesjährigen Programm des Neue-Musik-Festivals MaerzMusik ragt ein Werk des vielversprechenden jungen österreichischen Komponisten Franz Schubert heraus. Es heißt nicht algor/rigor:::fragments VII oder Genetics-based Melancholy Pt. I & II, sondern peinlich schlicht Winterreise. 
Aber kein Mensch, der Musik liebt, wird sich lange darüber wundern oder gar beschweren, wie dieses Werk ins Programm geraten ist. Zumal wenn Ian Bostridge es singt und Julius Drake am Klavier… nein, nicht begleitet. Gegen den Usus soll hier einmal mit dem Spiel des Pianisten begonnen werden: nicht nur weil die Frau des Konzertgängers nach dem Konzert im Kammermusiksaal von ihm geträumt hat (dem Klavierspiel, nicht Mr Drake, obwohl der ein stattliches Mannsbild ist), sondern weil es so bizarr, bewegt und durchdacht ist, dass das Wort kongenial fallen muss. Zu Beginn des Zyklus schreitet Drake nicht einfach los, sondern stürzt mit einem furchterregenden Crescendo in die Tiefe. Die Wetterfahne lässt er mit ekstatisch zitterndem Fuß auf dem Pedal flattern, ein Effekt, den er später wiederholt, etwa im Frühlingstraum. Im Lindenbaum forciert und verschleppt er derart, dass das Lied in seine Einzelteile zu zerfallen droht. Die Tonrepetitionen im Irrlicht zucken so beängstigend synkopisch, dass sie auch den verwirrten Hörer in die tiefsten Felsengründe zu locken drohen. Das Hundebellen und Kettenrasseln Im Dorfe lässt Drake aus gedämpfter Traumtiefe heraufklingen, die Pausen dehnt er bis an den Rand des Erträglichen. Und der Leiermann leiert hier mit nie gehörter Hochspannung. Eins ist diese Winterreise gewiss nicht, nämlich fahl.
Nun wird kein ernstzunehmender Sänger Schuberts Winterreise biedermeierlich klingen lassen, aber so unbiedermeierlich wie bei Bostridge dürfte sie dennoch selten wirken. Denn alles, was an Drakes Spiel packt und begeistert, gilt auch für Bostridges Interpretation, nur dass hier eine visuelle Komponente dazukommt, während Drake selbst die bizarrsten Dinge völlig stoisch tut. Bostridge hingegen ist exaltiert bis zur Karikatur, auf eine Weise, die Hörer zu berauschten Zuschauern werden lässt; auch wenn der eine oder andere Fischer-Dieskau-Veteran vielleicht lieber die Augen schließt. Bereits in Gute Nacht wankt und schwankt Bostridge, beugt sich, stützt sich ab, quetscht die Töne aus dem Mundwinkel, dass man um seine Gesundheit fürchtet. Man erinnert sich, dass Christian Gerhaher (als Sänger natürlich ein völlig anderes Temperament) vor zwei Jahren in der Winterreise zusammenbrach und sich hinter der Bühne fit spritzen ließ, um den Zyklus zum Ende zu bringen. Aber Bostridge bleibt auf den Beinen, auch wenn er den Höchste-Expressions-Modus nicht verlässt: meiner Liebsten Haus in der Wasserflut oder reißend schwillt in Auf dem Flusse deklamiert, ja ruft er so laut, dass es fast weh tut. Er verwandelt nicht nur seine Stimme, sondern sich selbst in die Krähe, so wie er insgesamt nicht darstellt, sondern der romantische Wanderer ist. An einigen Stellen mögen andere Sänger etwas anschaulicher tonmalen, die Melismen im Greisen Kopf noch kunstvoller singen. Aber an Intensität dürfte Bostridge selbst unter den größten Liedsängern einzigartig dastehen. Beziehungsweise wanken und schwanken. Das letzte Wort, drehn, singt er mit einem Crescendo, dass es zum Schrei wird. Nach Sterben klingt das nicht, eher nach Zerrissenheit, die unbedingt leben will.
Die Offenheit der Winterreise betont Bostridge auch im anschließenden Podiumsgespräch mit der lustigen Philharmonikerin Sarah Willis (die die Winterreise zum ersten Mal live gehört hat, als Hornistin gehe sie lieber zu Strauss und Mahler). Trotz Pause ist der relaxte Talk nach den Eruptionen der Musik natürlich emotional etwas diminuierend. Gleichwohl sehr interessant, Bostridge trinkt Hefeweizen, spielt während des Sprechens mit einem riesigen Schlüssel herum, dankt dem Publikum für die lange Stille vor dem Beifall, legt dar, dass Schubert die Winterreise ursprünglich tatsächlich für Tenor, nicht Bariton komponiert habe, und liest aus seinem Buch über die Winterreise (das keinesfalls so schwierig ist, wie Willis behauptet, sondern bei aller Gelehrsamkeit gut lesbar). Die Frage, warum die Berliner und Wiener dem Genre des Lieds weitgehend abgeschworen haben, während in der Londoner Wigmore Hall 95 Liederabende pro Jahr stattfinden, kann auch er nicht beantworten.
13.3.2013 – Ra(s)tlos: Winterreisen von Elfriede Jelinek und Bernhard Lang bei MaerzMusik
Ein mysteriöser Schwerpunkt im überaus bunten Programm der diesjährigen MaerzMusik ist die Winterreise. Bevor am Dienstag der einzigartige Ian Bostridge im Kammermusiksaal den Liederzyklus singt, gab es am Sonntag im Haus der Berliner Festspiele zwei Variationen von unsicherem Verwandtschaftsgrad zu Schubert.
Elfriede Jelinek ist, wie die Komponistin Olga Neuwirth betont, kein männlicher Nobelpreisträgeranwärter, sondern eine weibliche Literaturnobelpreisträgerin, wird aber trotzdem oder gerade deshalb viel und meist von Männern geschmäht. Aus ihrem Theaterstück Winterreise (2011) liest die Schauspielerin Sophie Rois, die stets als fulminant bezeichnet wird, was hiermit ebenfalls geschieht: Sie schmollt, ruft, raunt, höhnt und jammert, dass es eine Freude ist, quetscht jede mögliche Pointe heraus. Nur leiern tut sie im Grunde nie. So scheint Jelineks rastlose Litanei, in der die Leierfrau ihre eigene Biografie ebenso plündert wie die ZIB-Nachrichten, mal phänomenal assoziierend, mal nervig kalauernd, manchmal fast zu unterhaltsam. Zwischendurch gibt es Winterreise-Lieder, gesungen von Julius Patzak; obwohl aus einem scheppernden Ghettoblaster, löst die Musik kurioserweise im Publikum sofort Hustenreflexe aus. Gute Nacht erklingt zweimal, zu Anfang und Ende, Sophie Rois singt am Schluss ein bisschen mit. Indem aber das Gutenachtlied, das Schubert so verstörend an den Anfang gestellt hat, dorthin zurückkehrt, wo es ja eigentlich hingehören würde, nämlich an den Schluss, wirkt diese Winterreise am Ende irritierend konventioneller als das Original.
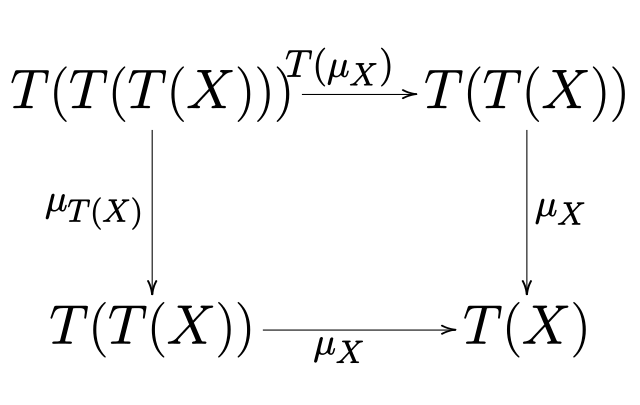 Der zweite dubiose Verwandte ist The Cold Trip aus der Serie Monadologie des österreichischen Komponisten Bernhard Lang, über den man im Programmheft erfährt, dass er als Komponist gern in großen Zyklen in die Tiefe des Details denkt und die Simulation musikalischer Automatismen erforscht. Nun ist die großspurige Neue-Musik-Salbaderei ein Ärgernis für sich und sollte keinesfalls gegen einen einzelnen Komponisten gewendet werden. Aber dem Konzertgänger, der raffinierte Texturen zwar nicht intellektuell durchdringt, aber hörend genießt, bleibt Langs dürre Musik mit ihren kargen Wiederholungen und plakativen Abbrüchen verschlossen. Zuerst vom Aleph Gitarrenquartett, dann von Mark Knoop an Klavier und Laptop begleitet performen die Stimmakrobatinnen Sarah Maria Sun und Juliet Fraser eindrucksvoll den ins Englische übersetzten Text Wilhelm Müllers. Je länger, desto deutlicher hörbar werden gewisse Schubert-Module. Aber im Mittelpunkt steht die Hervorhebung der Winterwörter: cold, freeze, shiver, despair, sting zittern, bibbern und stechen die Stimmen, und wenn es crow heißt, krächzt Fraser krähenmäßig. Das ist lustig, aber auch so text(fetzen)nah komponiert, dass im Vergleich dazu das Wort-Ton-Verhältnis bei Richard Strauss geradezu abstrakt wirkt.
Der zweite dubiose Verwandte ist The Cold Trip aus der Serie Monadologie des österreichischen Komponisten Bernhard Lang, über den man im Programmheft erfährt, dass er als Komponist gern in großen Zyklen in die Tiefe des Details denkt und die Simulation musikalischer Automatismen erforscht. Nun ist die großspurige Neue-Musik-Salbaderei ein Ärgernis für sich und sollte keinesfalls gegen einen einzelnen Komponisten gewendet werden. Aber dem Konzertgänger, der raffinierte Texturen zwar nicht intellektuell durchdringt, aber hörend genießt, bleibt Langs dürre Musik mit ihren kargen Wiederholungen und plakativen Abbrüchen verschlossen. Zuerst vom Aleph Gitarrenquartett, dann von Mark Knoop an Klavier und Laptop begleitet performen die Stimmakrobatinnen Sarah Maria Sun und Juliet Fraser eindrucksvoll den ins Englische übersetzten Text Wilhelm Müllers. Je länger, desto deutlicher hörbar werden gewisse Schubert-Module. Aber im Mittelpunkt steht die Hervorhebung der Winterwörter: cold, freeze, shiver, despair, sting zittern, bibbern und stechen die Stimmen, und wenn es crow heißt, krächzt Fraser krähenmäßig. Das ist lustig, aber auch so text(fetzen)nah komponiert, dass im Vergleich dazu das Wort-Ton-Verhältnis bei Richard Strauss geradezu abstrakt wirkt.
Das Publikum scheint aber großteils enthusiasmiert von diesem psychedelischen Palimpsest-Sampling.
Zu MaerzMusik / Zum Anfang des Blogs
12.3.2016 – Unkanarisch: Computerkompositionen bei MaerzMusik
Wenn Computer mittlerweile nicht nur in Trivialspielen wie Schach, sondern sogar im verzwackten Go humane Champions ausknocken, warum sollen sie nicht auch komponieren? Bei MaerzMusik stellen menschliche Musiker am Samstag im Haus der Berliner Festspiele mehrere Werke vor, die von Maschinen komponiert wurden:  Zunächst in einem historischen Exkurs ein von nahezu antiker Informatik ersonnenes Streichquartett, die Illiac Suite von 1957. Offenhörlich wurde das Programm mit diversen Streichquartetten und Harmonielehrbüchern gefüttert, die ersten Sätze sind diatonisch, die hinteren chromatisch. Da denn doch das gewisse musikalische Etwas fehlt, beschäftigt man sich wie beim lustigen Zitatesuchen damit, den Input herauszuhören und sich über die Individuierung durch die menschlichen Musiker zu freuen, vier Streicher vom Ensemble KNM Berlin.
Zunächst in einem historischen Exkurs ein von nahezu antiker Informatik ersonnenes Streichquartett, die Illiac Suite von 1957. Offenhörlich wurde das Programm mit diversen Streichquartetten und Harmonielehrbüchern gefüttert, die ersten Sätze sind diatonisch, die hinteren chromatisch. Da denn doch das gewisse musikalische Etwas fehlt, beschäftigt man sich wie beim lustigen Zitatesuchen damit, den Input herauszuhören und sich über die Individuierung durch die menschlichen Musiker zu freuen, vier Streicher vom Ensemble KNM Berlin.
Da sind die aktuellen Elaborate des Iamus Computers des Biomimetischen Instituts der Universität Málaga schon eine andere Herausforderung. Man erfährt, dass Iamus seine Werke generiert, indem er, evolutionäre Prozesse simulierend, musikalische DNA mutiert – was auch immer das heißen mag, das Hörerlebnis ist verstörend. Der Pianist Gustavo Díaz-Jerez spielt (mit Papiernoten und Umblattlerin) mehrere Stücke am Konzertflügel vor, die ziemlich komplex dahinfließen. Offenbar, sagt das Ohr, in den Jahren nach 1900 komponiert. Zweifellos hielte man es für ein sehr atmosphärisches Stück, wenn Díaz-Jerez, der auch Komponist ist, es als sein eigenes Werk ausgäbe, vielleicht mit dem Titel Noche Canaria. Aber wir wissen ja, woher es kommt; zumindest ungefähr, das mit der Simulation evolutionärer Prozesse und Mutation musikalischer DNA haben wir nicht verstanden.
Man kann nun die Augen schließen und sich als Ort dieser Musik eine Planet-Solaris-Cogitare-ergo-essere-Sphäre vorstellen. Oder als Urheber einen qua Mysterium depersonalisierten Skrjabin. Aber das hilft nur bedingt. Obwohl der Musikfrankenstein der Universität Málaga Francisco José Vico überaus sympathisch wirkt und zur Diskussion einlädt, setzt sofort nach dem letzten Ton eine geradezu panikartige Flucht des Publikums ein, die beweist, dass dieses Konzert (ex negativo) an etwas Entscheidendes rührt, was Musik selbst in ihrer avantgardistischsten Form den meisten Menschen bedeutet: Kommunikation mit einem Urheber. Man begreift schlagartig, wie sich ein Mensch in Konzerten fühlen muss, dem (wie etwa Robert Musil) der Rezeptor für die kommunikative Qualität von Musik völlig abgeht: gewaterboarded. Ob sich Díaz-Jerez‘ Vorschlag erfüllen wird, der Tondichter der Zukunft solle Iamus ganz pragmatisch als kompositorisches Tool benutzen, bleibe dahingestellt.
11.3.2016 – Konjunktivisch: Marino Formenti eröffnet die MaerzMusik
 Dieses Konzert treibt dem Konzertgänger den Griesgram aus, der tief in ihm steckt: Sich einlassen oder gleich abhauen heißt die Devise, wenn der Pianist Marino Formenti die diesjährige MaerzMusik eröffnet, zum zweiten Mal mit dem Untertitel Festival für Zeitfragen. Dem Kritiker der Berliner Zeitung hat bereits die Lektüre des Programms die Laune verhagelt, Casus knacksus seines Tadels: zu viel Gelaber, zu wenig Musik. Nun hat sich auch dem Konzertgänger schon während seines geisteswissenschaftlichen Studiums das tolle Treiben der Diskurserotiker nie erschlossen, darum meidet er die umfangreiche Thinking Together-Konferenz des Festivals zum Thema Zeit und Digitalisierung (für Diskursmasochisten auch als 12stündiger Livestream) wie der Teufel das Weihwasser.
Dieses Konzert treibt dem Konzertgänger den Griesgram aus, der tief in ihm steckt: Sich einlassen oder gleich abhauen heißt die Devise, wenn der Pianist Marino Formenti die diesjährige MaerzMusik eröffnet, zum zweiten Mal mit dem Untertitel Festival für Zeitfragen. Dem Kritiker der Berliner Zeitung hat bereits die Lektüre des Programms die Laune verhagelt, Casus knacksus seines Tadels: zu viel Gelaber, zu wenig Musik. Nun hat sich auch dem Konzertgänger schon während seines geisteswissenschaftlichen Studiums das tolle Treiben der Diskurserotiker nie erschlossen, darum meidet er die umfangreiche Thinking Together-Konferenz des Festivals zum Thema Zeit und Digitalisierung (für Diskursmasochisten auch als 12stündiger Livestream) wie der Teufel das Weihwasser.
Aber der sympathische Pianist Marino Formenti, der das Eröffnungskonzert (vulgo Opening: Time to gather) im Haus der Berliner Festspiele gibt, ist alles andere als ein theorieseliger Plapperfroh. Wenn er in seinem italienisch gefärbten Wienerisch zum Publikum spricht, dann mit der Aufforderung, sich mal locker zu machen und bittebitte zwischendurch etwas zu trinken zu holen (aber, wir sind ja in Deutschland, nur Becher in den Saal, keine Gläser). Die Hörer sitzen nicht im Saal, sondern auf der Bühne ums Klavier, auf Sesseln, Sofas, Hockern, Bänken, dem Boden und weit verteilten Matratzen. Digitalisiert ist hier nichts, nur die Zeit dehnt sich: Es gibt kein festgelegtes Programm, zum Start ertönen die unterarmdreschende 6. Sonate von Galina Ustwolskaja und das ätherische Wiegenlied des alten Franz Liszt. Für das weitere Programm nimmt Formenti Wünsche entgegen, er hat die mitgebrachten Noten über mehrere Tische ausgebreitet; und das Publikum ist auch eingeladen, ans Klavier zu kommen und etwas vorzuspielen. Am Anfang zieht es sich, einige Interessierte schwarwenzeln ums Klavier, aber keiner traut sich so recht; man wäre schon dankbar, wenn jemand den Flohwalzer darböte.
Doch wer den inneren Griesgram überwindet und nicht abhaut, sondern abwartet und Tee trinkt (oder Sekt), der wird belohnt. Formenti spielt sehr wandelbar und zum Glück nicht als Hintergrundbeschallung, er bittet das relaxte Publikum während der Stücke um Ruhe. In größeren Abständen erklingen eine Sarabande von J. S. Bach, eine heftige Clusterbrumme von Giacinto Scelsi (im Unterschied zu Ustwolskajas spröde donnernder Hardcore-Spiritualität ein südländisch feuriges Klanggewitter, bei dem allerdings den Hörern auf der Matratze unter dem Flügel das Lachen vergehen dürfte), John Lennon, ein paar Takte Griechischer Wein, eine Scarlatti-Sonate, eine Geschwind-Gnossienne von Eric Satie, introvertierte Préludes von Gaspard le Roux und dann wieder Cluster, diesmal frei nach Smells like Teen Spirit von Nirvana.
Als Formenti gegen 22 Uhr die Hörer für seine Verhältnisse fast unwirsch auffordert, aufzustehen und herumzugehen, zu trinken, zu flirten, sonst könnt ihr gleich in die Philharmonie gehen, entspannt sich der Konzertgänger zähneknirschend und legt sich auf eine Matratze in der Seitenbühne, was tatsächlich recht angenehm ist. Mittlerweile ist auch das Eis geschmolzen und einige Gäste setzen sich ans Klavier, offenbar ist mancher (Semi-)Profi im Publikum. Ein älterer Syrer namens Mohammed singt a cappella ein wehmütig wirkendes melismatisches arabisches Lied, später wagt sich ein todesmutiger Herr mit brüchiger Stimme an den Leiermann aus der Winterreise. Viel Bach, zwischendurch kann man rumgehen und die Bühnenbeleuchtung inspizieren oder Wein trinken; die Herren von der Qualitätspresse gucken weiterhin sauertöpfisch.
Durchaus unspontan und akkurat vorbereitet ist aber der Höhepunkt des Programms, den Mario Formenti kurz vor 23 Uhr spielt, das 30minütige Stück DW 12 Cellular Automata for solo piano (danke an Dominique Schweizer für den Titel) von Bernhard Lang zwischen Free Jazz, Nocturne und Klaviertechno, in dem irgendwann in einer Clusterkanonade auch die Fanfaren der Hammerklaviersonate auftauchen.
Ein ziemlich konjunktivisches, aber sehr sympathisches Konzert. In den nächsten Tagen gibt es vom Computer komponierte Musik und einen Winterreise-Schwerpunkt (Schubert ist immer zeitgenössisch), außerdem ein nächtliches Schlafkonzert und einen 30-Stunden-Gig.
Zum Konzert / Zum Gesamtprogramm der MaerzMusik / Zum Anfang des Blogs




Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.