Ein echter Ring-Rausch beginnt schon beim Einspielen des Orchesters. Im Wirrwarr der Klänge vor dem Rheingold wartet man auf die Stille, aus der der Ur-Ton erstehen wird; und wenn aus dem Warmmachen vor der Walküre immer wieder das Hundingmotiv heraufhörnt, so spürt man bereits die in mystischer Ferne längst schon stattfindenden zährenden Zwangsheiraten und jähen Jagden. Der Ring des Nibelungen der Staatsoper Unter den Linden Berlin, der am vergangenen Wochenende seinen zweiten Durchlauf begann, ist dabei eine Welt in Ur-Ordnung ohne Mitteletage: in wonnigem Walhall wesen Orchester und fast alle Sänger, während die Regie nebulös nibelheimt. Dazwischen – niente, nitschewo, nothing.
So international tönt’s im Publikum, das trotz bescheidener Inszenierungs-Reputation aus aller Damen Länder nach Berlin geströmt ist. Ob aber London, Paris oder Madrid: Am Sonntag werden sie sich wohl wundern, wie Unter den Linden der Autoverkehr und sogar ein stinkender Motorradkorso vorbeiknattert, obwohl doch „autofreier Sonntag“ sein sollte. In diesen Städten traut man sich längst mehr gegen die zwangvolle Plage privates Automobil.
Nun, die Ring-Welt ist glücklicherweise autofrei. Und gekommen sind die meisten fernen Besucher wohl nicht zuletzt wegen des exzeptionellen Wagner-Dirigenten Daniel Barenboim. Und da kann man sagen, was man will, aber wenn’s Wagner gilt, ist Barenboim, was er ist, nicht nur durch Verträge. Bedungen ist seine Macht unter anderem durch eine Kunst der Temporückungen, die ihresgleichen sucht. Seinen Atem könnte man lobpreisen, eine ars rubatorum, die immer dicht am gesungenen Wort ist und doch weite Bögen schafft. Groß sind die Momente, wenn in der fesselnd straffen Dramaturgie des ersten Walküre-Aufzugs plötzlich alles stillsteht: wenn das Walhall-Motiv unendlich langsam ertönt, nachdem Wölfing-Siegmund den Vater fand ich nicht mehr sang. Oder wenn, ebenfalls in extremer Verlangsamung des Orchesterparts, Sieglinde dem Klang erinnerter Stimmen nachsinnt. Es ist, als fielen wir, dabei noch japsend vor Spannung, plötzlich aus der Zeit.
Stets aus organisch scheinendem Strömen und Fließen der Musik treten die Leitmotive hervor, sehr deutlich, aber niemals zeigefingernd. Hübsch mystisch ists ja auch, wie Barenboim sich hereinschleicht und ohne Begrüßungsapplaus loslegt: als wär man in Bayreuth, nur halt bei offenem Graben. Im Rheingold hustet und tuschelts dann leider aus dem Publikum noch arg in die Erschaffung der Welt hinein, während der stürmische Walküre-Beginn die lästigen Störungen zackzack wegföhnt.
Und der Rang der Staatskapelle mit ihrem warmen, ja glühenden Klang steht an diesen ersten beiden Ring-Abenden außer Frage, selbst wenn Brünnhilde und das Blech sich im dritten Aufzug der Walküre mal aus den Augen verlieren. Bei diesem Gesamtkunstwerk in sich, der Farb- und Spannungsebenen des Orchesters nämlich, ist die Architektur vollkommen stimmig: von den zauberhaften Streichern über das Holz, das strahlt wie Freias leuchtendes Auge, bis hin zu diesem großartigen Edelmetallgebläse, tastend und changierend am Rheingoldbeginn, brutal und düster im Nibelheimgrauen, prachtvoll in Walhall, von mysteriöser Majestät in der Todesverkündigung.
Unendlich scheinen die möglichen Einfälle zum Ring des Nibelungen, sowohl an Bildern als auch an Gedanken. Da möchte man über die fade Inszenierung von Guy Cassiers am liebsten gar kein Wort verlieren. Wirr die Gedanken, nichtssagend die Optik. Anton Schlatz urteilte anlässlich des ersten Ring-Durchlaufs hart, aber wohl treffend: Cassiers war und ist der derbste Fehlgriff – weil mit einem Schlag vier Abende betroffen sind – eines Berliner Opernhauses des letzten Jahrzehnts.
Und da es unflätig ist, einen toten Niblung nochmals zu verdreschen, würde man gern das Positive heraussuchen. Was böte sich an? Vielleicht, wie Cassiers im Rheingold die Figur des Loge hervorhebt, als zappligen Conférencier mit Weitblick zum Untergang, fast einen diabolischen Marionettenspieler. Auch der Auftritt der Riesen hat was, Witz sogar, wie sie beide im Anzug daherkommen, eine Hand in der Hosentasche, und Fafner am Anfang, als erstmal nur Fasolt faselt, jede Bewegung des Bruders imitiert. Und man weiß ja schon, dass er ihn später töten wird.
Insgesamt aber ist das peinliches Rumstehtheater, minunter geradezu stümperhaft. Und unmusikalisch: Reagiert die statische Bühne doch mal auf die Musik, dann nur auf deren oberflächlichste Reize: Im Rheingold ahmen Tänzer nur die allerdeutlichsten instrumentalen Gesten nach, und im dritten Aufzug der Walküre fallen sich Wotan und Brünnhilde zum dicksten Crescendo-Bumps in die Arme. Ein deprimierend oberflächlicher Moment. Ansonsten wird der Stillstand nicht nur durch unmotivierte gymnastische Einlagen kaschiert, sondern auch durch Projektionen, läppische Schattenspiele, irgendeine Drehkugel. Manch einer wird aber bald die Augen geschlossen haben, um diese Musik als konzertante Aufführung zu genießen. Denn hier wirbt Cassiers‘ einfallsloses Rampensingen seinen hehrsten Gewinn: Die Sänger werden kaum behindert.
Und sängerisch ist das ein Fest, in einigen Partien geradezu unvergesslich.
Erhebliche Abstriche gibt es aus Sicht des Konzertgängers nur bei Simon O’Neill. So rollendeckend dessen gedeckelter Tenor in der Rolle des Froh scheint, so unzureichend, ja fachfremd wirkt diese Stimme für den Siegmund. Dabei singt er ja nicht falsch und seine Gestaltung macht einiges wett; es ist eher ein Problem des Timbres, dem jedes Strahlen fehlt. So ist der erste Akt der Walküre, obwohl hinsichtlich der Orchesterleistung ein Höhepunkt, gesanglich am durchwachsensten – trotz Anja Kampe, deren Stimme in den letzten Jahren eindrucksvoll „gewachsen“ scheint; ein wenig auf Kosten des Lyrischen und bei manchmal etwas unbedarft wirkender Text-Interpretation. Keinen Moment aber zweifelt man in diesem ersten Akt, dass der markante Hunding von Falk Struckmann den Wälsung Siegmund mit einer einzigen Backpfeife erledigen kann.
Als Fafner ist Struckmann bereits am Vorabend mit dem Fasolt von Matti Salminen unterwegs: einer lebenden Legende, die den Ring bekanntlich schon gesungen gesungen hat, als Wagner noch gar nicht geboren war. Es ist wirklich bewegend, Salminen noch einmal zu erleben, obwohl oder gerade weil er stimmlich an Struckmann natürlich nicht mehr heranreicht. Ja, es ist sehr deutlich die Stimme eines alten Mannes, gefährdet und fast brüchig in ihrer Mächtigkeit. In der Rolle des Fasolt, dieser kleinen unglücklichen Liebesgeschichte zur Lebenshüterin Freia, berührt diese Stimme außerordentlich. Und wenn Salminen am Ende des Rheingolds den gewaltigsten Beifall erhält, dann ist das nicht nur der Beifall für sein Lebenswerk, sondern auch für dieses anrührende Porträt.
Sehr befriedigend sind die sogenannten kleineren Rollen besetzt: die Rheintöchter Evelin Novak, Natalia Skrycka und Anna Lapkovskaja etwa, die im Terzett fast Operettenleichtigkeit aufkommen lassen, die Wilde Acht der Walküren und diese hampelig-unschlüssige Götterbande, unentschlossener und hilfloser als ein Klimakabinett. Der exakte Roman Trekel als Donner sticht da hervor. Die Fricka der Ekaterina Gubanova kehrt in der Walküre wieder und hat da ihren großen Auftritt, eine Wotansgattin ohne Xanthippenhaftigkeit. Wohl stählt sich ihre Stimme in der Walküre gegenüber den lustspieligen Momenten im Rheingold, aber Gubanova macht deutlich, dass die wiederholt gedemütigte Göttin einfach schlauer ist als ihr Gatte. Und die besseren Argumente hat.
Stephan Rügamer aber wird als Loge in einer Weise zum Zentrum des Rheingolds, das man nicht unbedingt erwartet hätte, wenn man diesen – durchaus geschätzten! – Sänger sonst hört. Sein Tenor mag etwas monochrom sein, aber was Rügamer mit enormem Witz und giftigem Charme aus dem Angebot der Inszenierung macht, ist überragend. Im Siegfried wird Rügamer den Mime singen. Darauf freut man sich einerseits, nämlich wegen Rügamer; andererseits bedauert man es, und zwar wegen Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, der nicht nur einen großartigen Doppelnamen hat, sondern dessen Mime im Rheingold einen vorzüglich jammert.
Bei fast allen Sängern besticht die enorme Textverständlichkeit. Eine Ausnahme ist gewiss die Brünnhilde von Iréne Theorin mit ihrem gewaltmächtigen Wobble, aber Kontrolle und Innigkeit dieser Stimme sind selbst auf 450 Grad Fahrenheit so immens, dass das kein Einwand ist. Vor allem gelingt es ihr, die ungeheuerliche Entwicklung dieser Figur im zweiten Akt der Walküre völlig überzeugend darzustellen, die vielleicht der entscheidende Kipppunkt der Tetralogie ist: vom fast kindlichen Heijatoho der Vatertochter zur Sterblichenversteherin, die Walvaters Willen trotzt. Am eindrucksvollsten sind, trotz Theorins umwerfenden Volumens, die leisen Töne: Ihr So wenig achtest du ewige Wonne? geht einem durch Mark und Bein.
Die vielleicht beiden Allerbesten unter so vielen Besten zuletzt: Jochen Schmeckenbechers Alberich ist ungeheuer interessant, weil er so weit übers Dämonische hinausreicht, eine gebrochene Persönlichkeit. Das ist ein äußerst differenziertes Porträt, das auf alles Plakative verzichtet, und insofern auf Augenhöhe mit Michael Volle, einem – so fühlt es sich hier an – Wotan für die ewigen Bücher der Wagnergeschichtsschreibung. Volle gibt den Göttervater in unvergleichlich durchlebter und durchleuchtender Textbehandlung und nahezu ohne jeden Ausstoß von nordischem Wotantestosteron. Und wenn er zumal im dritten Akt der Walküre, dieser herzzerbrechenden Abschiedsszene mit Brünnhilde, einen klagenden Ton voller Schmelz, geradezu italianità hören lässt, dann weiß man, dass Volle ein großer Sänger auf dem Zenit seiner Kunst ist. Und man ist glücklich, dabei zu sein.
Berichte zu Siegfried und Götterdämmerung folgen. Rollen Sie doch noch ein paar Zentimeter weiter nach unten und abonnieren Sie mutig dieses Blog. Kostet nix, außer gelegentlich Lesezeit, versprochen.
Nachtrag: Kritik zum „Siegfried“ und zur „Götterdämmerung“
Weitere Kritiken: Der unermüdliche Schlatz dokumentiert gleich beide Ring-Zyklen! Siehe Rheingold & Walküre I — Rheingold II — Walküre II


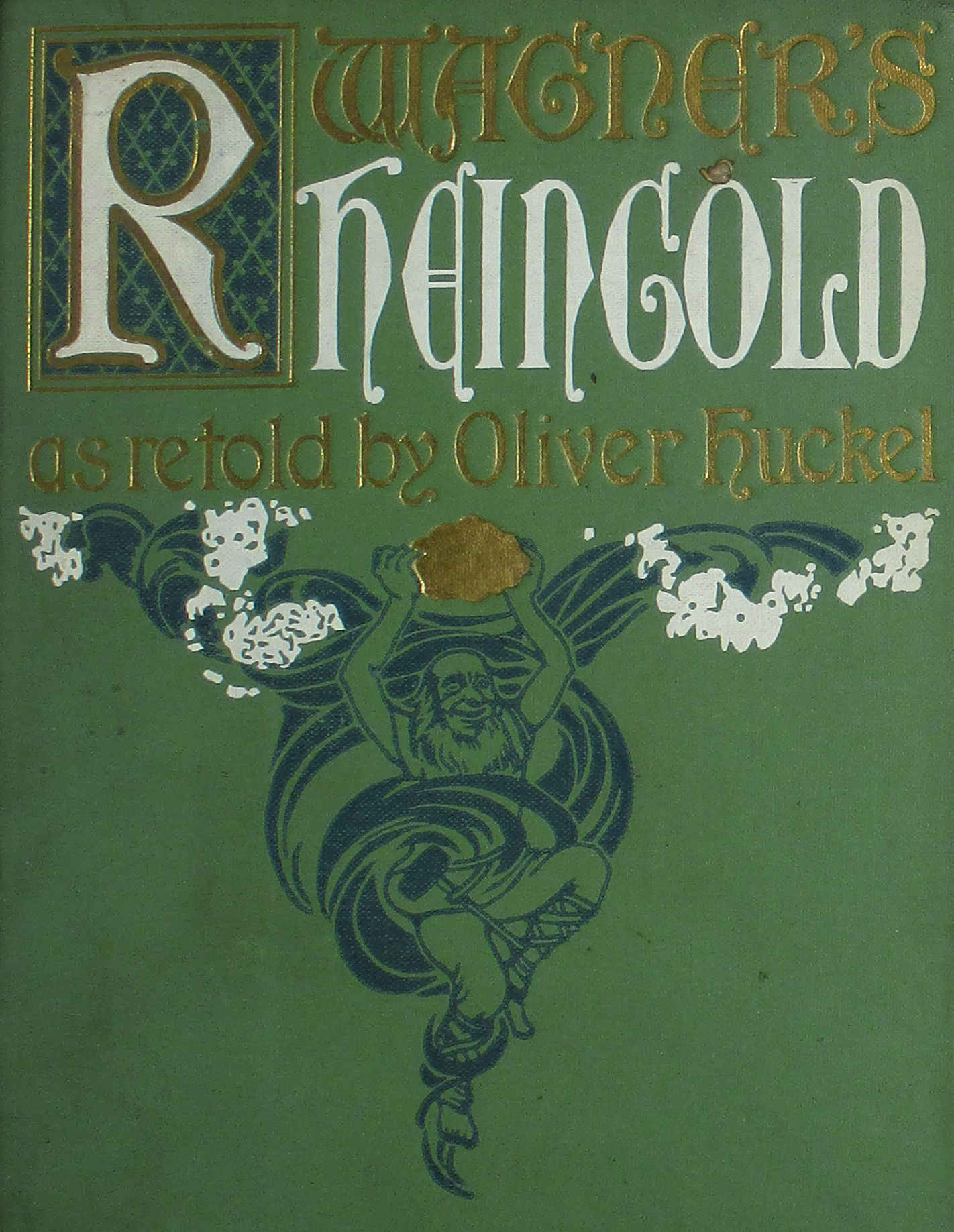



Sehr schön von Ihnen beschrieben, was das Dirigat Barenboims ausmacht. Bei Simon O’Neill bin ich anderer Meinung. Und Kampes „unbedarft wirkende Text-Interpretation“ habe ich so auch nicht gehört. An Salminen habe ich mich jetzt gewöhnt, ganz OK ist das nicht, wie er rau und rostig singt, aber gut…
Muss wohl mal versuchen, O’Neill mit Ihren Ohren zu hören. Als ich O’Neill letztes Jahr unter Runnicles als Siegfried gehört habe, kam mir das fast wie Kabarettismus vor.
Kampes Sieglinde habe ich auch in München gehört, da fand ich sie konzentrierter. Ihre Isolde gefällt mir auch.
Diskussion auch auf der Facebook-Seite des Blogs.
Wunderbar und sehr treffend beschrieben, lieber Albrecht Selge. Ich hatte im 3. Rang einen sehr guten Hörplatz, der für diese „Inszenierung“ vollkommen ausreichte. Die Walküre musste ich leider mangels Krankheit schwänzen, hoffe aber, beim Siegfried und der Götterdämmerung wieder fit zu sein. Danke für den tollen und ausführlichen Bericht!
Hörplatz ist eine gute Wahl. Ich wünsche gute Besserung!