Ein mysteriöser Schwerpunkt im überaus bunten Programm der diesjährigen MaerzMusik ist die Winterreise. Bevor am Dienstag der einzigartige Ian Bostridge im Kammermusiksaal den Liederzyklus singt, gab es am Sonntag im Haus der Berliner Festspiele zwei Variationen von unsicherem Verwandtschaftsgrad zu Schubert.
Elfriede Jelinek ist, wie die Komponistin Olga Neuwirth betont, kein männlicher Nobelpreisträgeranwärter, sondern eine weibliche Literaturnobelpreisträgerin, wird aber trotzdem oder gerade deshalb viel und meist von Männern geschmäht. Aus ihrem Theaterstück Winterreise (2011) liest die Schauspielerin Sophie Rois, die stets als fulminant bezeichnet wird, was hiermit ebenfalls geschieht: Sie schmollt, ruft, raunt, höhnt und jammert, dass es eine Freude ist, quetscht jede mögliche Pointe heraus. Nur leiern tut sie im Grunde nie. So scheint Jelineks rastlose Litanei, in der die Leierfrau ihre eigene Biografie ebenso plündert wie die ZIB-Nachrichten, mal phänomenal assoziierend, mal nervig kalauernd, manchmal fast zu unterhaltsam. Zwischendurch gibt es Winterreise-Lieder, gesungen von Julius Patzak; obwohl aus einem scheppernden Ghettoblaster, löst die Musik kurioserweise im Publikum sofort Hustenreflexe aus. Gute Nacht erklingt zweimal, zu Anfang und Ende, Sophie Rois singt am Schluss ein bisschen mit. Indem aber das Gutenachtlied, das Schubert so verstörend an den Anfang gestellt hat, dorthin zurückkehrt, wo es ja eigentlich hingehören würde, nämlich an den Schluss, wirkt diese Winterreise am Ende irritierend konventioneller als das Original.
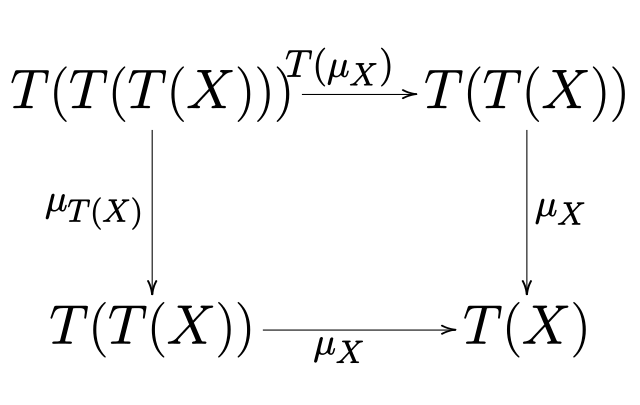 Der zweite dubiose Verwandte ist The Cold Trip aus der Serie Monadologie des österreichischen Komponisten Bernhard Lang, über den man im Programmheft erfährt, dass er als Komponist gern in großen Zyklen in die Tiefe des Details denkt und die Simulation musikalischer Automatismen erforscht. Nun ist die großspurige Neue-Musik-Salbaderei ein Ärgernis für sich und sollte keinesfalls gegen einen einzelnen Komponisten gewendet werden. Aber dem Konzertgänger, der raffinierte Texturen zwar nicht intellektuell durchdringt, aber hörend genießt, bleibt Langs dürre Musik mit ihren kargen Wiederholungen und plakativen Abbrüchen verschlossen. Zuerst vom Aleph Gitarrenquartett, dann von Mark Knoop an Klavier und Laptop begleitet performen die Stimmakrobatinnen Sarah Maria Sun und Juliet Fraser eindrucksvoll den ins Englische übersetzten Text Wilhelm Müllers. Je länger, desto deutlicher hörbar werden gewisse Schubert-Module. Aber im Mittelpunkt steht die Hervorhebung der Winterwörter: cold, freeze, shiver, despair, sting zittern, bibbern und stechen die Stimmen, und wenn es crow heißt, krächzt Fraser krähenmäßig. Das ist lustig, aber auch so text(fetzen)nah komponiert, dass im Vergleich dazu das Wort-Ton-Verhältnis bei Richard Strauss geradezu abstrakt wirkt.
Der zweite dubiose Verwandte ist The Cold Trip aus der Serie Monadologie des österreichischen Komponisten Bernhard Lang, über den man im Programmheft erfährt, dass er als Komponist gern in großen Zyklen in die Tiefe des Details denkt und die Simulation musikalischer Automatismen erforscht. Nun ist die großspurige Neue-Musik-Salbaderei ein Ärgernis für sich und sollte keinesfalls gegen einen einzelnen Komponisten gewendet werden. Aber dem Konzertgänger, der raffinierte Texturen zwar nicht intellektuell durchdringt, aber hörend genießt, bleibt Langs dürre Musik mit ihren kargen Wiederholungen und plakativen Abbrüchen verschlossen. Zuerst vom Aleph Gitarrenquartett, dann von Mark Knoop an Klavier und Laptop begleitet performen die Stimmakrobatinnen Sarah Maria Sun und Juliet Fraser eindrucksvoll den ins Englische übersetzten Text Wilhelm Müllers. Je länger, desto deutlicher hörbar werden gewisse Schubert-Module. Aber im Mittelpunkt steht die Hervorhebung der Winterwörter: cold, freeze, shiver, despair, sting zittern, bibbern und stechen die Stimmen, und wenn es crow heißt, krächzt Fraser krähenmäßig. Das ist lustig, aber auch so text(fetzen)nah komponiert, dass im Vergleich dazu das Wort-Ton-Verhältnis bei Richard Strauss geradezu abstrakt wirkt.
Das Publikum scheint aber großteils enthusiasmiert von diesem psychedelischen Palimpsest-Sampling.
Zu MaerzMusik / Zum Anfang des Blogs

 Zunächst in einem historischen Exkurs ein von nahezu antiker Informatik ersonnenes Streichquartett, die Illiac Suite von 1957. Offenhörlich wurde das Programm mit diversen Streichquartetten und Harmonielehrbüchern gefüttert, die ersten Sätze sind diatonisch, die hinteren chromatisch. Da denn doch das gewisse musikalische Etwas fehlt, beschäftigt man sich wie beim lustigen Zitatesuchen damit, den Input herauszuhören und sich über die Individuierung durch die menschlichen Musiker zu freuen, vier Streicher vom
Zunächst in einem historischen Exkurs ein von nahezu antiker Informatik ersonnenes Streichquartett, die Illiac Suite von 1957. Offenhörlich wurde das Programm mit diversen Streichquartetten und Harmonielehrbüchern gefüttert, die ersten Sätze sind diatonisch, die hinteren chromatisch. Da denn doch das gewisse musikalische Etwas fehlt, beschäftigt man sich wie beim lustigen Zitatesuchen damit, den Input herauszuhören und sich über die Individuierung durch die menschlichen Musiker zu freuen, vier Streicher vom  Dieses Konzert treibt dem Konzertgänger den Griesgram aus, der tief in ihm steckt: Sich einlassen oder gleich abhauen heißt die Devise, wenn der Pianist Marino Formenti die diesjährige
Dieses Konzert treibt dem Konzertgänger den Griesgram aus, der tief in ihm steckt: Sich einlassen oder gleich abhauen heißt die Devise, wenn der Pianist Marino Formenti die diesjährige  Im Grunde ist ein fabelhaftes, hochvirtuoses Trompetenkonzert mit einigen szenischen Elementen zu erleben. Die Farbe Blau, die Michael zugeordnet ist, dominiert. Die Stationen der Reise werden mit simplen Requisiten dargestellt: Dom für Köln, siebenstrahlige Krone für New York, Bonsaibäumchen für Japan, Holzmaske für Bali usw. Musikalisch ist von serialistischen Umtrieben über gamelanige Weltmusik und erotische Harfenarpeggien bis zu elektronischer Echokunst alles dabei. Nur gesungen wird in dieser Oper nicht, auch nicht gesprochen, höchstens gehaucht, gepustet, geploppt, in Japan auch murmelnd bis 13 gezählt… Ein Klarinette spielendes Schwalbenpärchen sorgt für eine buffoneske Ebene. Das
Im Grunde ist ein fabelhaftes, hochvirtuoses Trompetenkonzert mit einigen szenischen Elementen zu erleben. Die Farbe Blau, die Michael zugeordnet ist, dominiert. Die Stationen der Reise werden mit simplen Requisiten dargestellt: Dom für Köln, siebenstrahlige Krone für New York, Bonsaibäumchen für Japan, Holzmaske für Bali usw. Musikalisch ist von serialistischen Umtrieben über gamelanige Weltmusik und erotische Harfenarpeggien bis zu elektronischer Echokunst alles dabei. Nur gesungen wird in dieser Oper nicht, auch nicht gesprochen, höchstens gehaucht, gepustet, geploppt, in Japan auch murmelnd bis 13 gezählt… Ein Klarinette spielendes Schwalbenpärchen sorgt für eine buffoneske Ebene. Das
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.