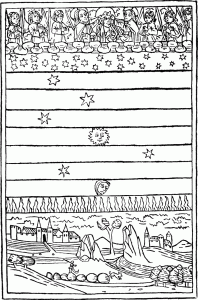 Wagner ist für Weicheier, Harteier gehen zum Streichquartett-Fest ins Berliner Konzerthaus. Acht Stunden dauert das. Gut, ein paar Pausen sind dabei, aber zwischen den Pausen: starker Tobak, kein Haydn oder Mozart, kein Ravel, sondern zweimal Spätes von Beethoven, dreimal Letztes von Schubert. Alles im Rahmen der Alfred-Brendel-Hommage.
Wagner ist für Weicheier, Harteier gehen zum Streichquartett-Fest ins Berliner Konzerthaus. Acht Stunden dauert das. Gut, ein paar Pausen sind dabei, aber zwischen den Pausen: starker Tobak, kein Haydn oder Mozart, kein Ravel, sondern zweimal Spätes von Beethoven, dreimal Letztes von Schubert. Alles im Rahmen der Alfred-Brendel-Hommage.
Mag man in der Großen Fuge auch mal einen Hänger haben: Wenn man so viel Streichquartett hört, kommen einem Beethovens Klavierkonzerte, die hier ebenfalls zyklisch aufgeführt werden, wie der reine Kuddelmuddel vor.
Nach Schuberts krassem G-Dur-Quartett schleicht der Konzertgänger jedoch im  Carl-Maria-von-Weber-Saal herum, schaut lange des Namensgebers Totenmaske an und hält unwillkürlich Ausschau nach einem Plätzchen, wo er sich selbst mit erstorbenen Zügen in die Mauer drücken könnte.
Carl-Maria-von-Weber-Saal herum, schaut lange des Namensgebers Totenmaske an und hält unwillkürlich Ausschau nach einem Plätzchen, wo er sich selbst mit erstorbenen Zügen in die Mauer drücken könnte.
Aber wie belebend wirken diese fabelhaften Quartette aus aller Herren Länder!
Die Quartette spielen im Großen Saal, aber verkehrt herum, en face der Orgelempore. Das Publikum sitzt auf der Bühne und auf den darüberliegenden Rangplätzen, mit Blick in die leeren Stuhlreihen. Erinnerungen ans Quartett aufs Ende der Zeit kommen auf, metaphysische Assoziationen. Aber auch konkrete Sorgen: Wird es sich mit der Akustik nicht verhalten wie mit der Heizung in einer riesigen Turnhalle oder einer Kirche, wo allzu viel in die falsche Richtung verloren geht?
Zum Glück nicht. Der heikle Saal sollte vielleicht jetzt immer verkehrt herum bespielt werden.
Das französische Quatuor Hermès, das mit Schuberts Streichquartett d-Moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“ eröffnet, ist hörbar etwas jünger als die folgenden Quartette, aber spielt beileibe mehr als bloß vielversprechend. Sehr hohes Niveau und eine Klischee-Widerlegung: Dass drei von vier Musikern asiatisch aussehen, heißt noch lange nicht, dass das Quartett es auf glatten Schönklang anlegen würde. Im Gegenteil, Hermès spielt so intensiv, dass es in einer Exaltation einmal drunter und drüber geht und das Cello in der finalen Todes-Tarantella einen kurzen Distortion-Effekt beisteuert. Qualitätsbeleg! Der erste Geiger Omer Bouchez geht in so tollkühner Expressivität voran, dass einem angst und bange wird. (Allerdings auch um die Zukunft dieses jungen Musikers, der eine krass verkrümmte Spielhaltung hat.)
Dann Schuberts letztes Streichquartett G-Dur D 887 mit dem überragenden britischen Doric String Quartet. Ein perfektes Schubert-Ensemble, es atmet, zittert, zagt und schreit wie ein einziger Organismus. Zugleich sind da vier charakterstarke Instrumente zu hören, deren Singenwollen in jedem Moment spürbar bleibt – auch und gerade wenn in diesem erschütternden Werk nichts weiter entfernt scheint als Gesang. Das Cello von John Myerscough im zweiten Satz lässt den Saal vor Sehnsucht bersten.
Was aber ist das für ein Instrument, fragt man sich, wenn man im Dankgesang von Beethovens Streichquartett a-Moll op. 132 die Augen schließt? So unendlich spröde und unendlich warm? Eine Art Engelsgambe vielleicht, einfach und tausendfältig zugleich? Es ist das spanische Cuarteto Casals. Ansonsten an diesem Abend in den musikalischen Ansätzen manchmal etwas uneinheitlich wirkend, aber eine faszinierende Mischung aus Intellektualität und Spielfreude.
Ein unerwarteter Höhepunkt (denn der Konzertgänger hat noch nie von ihm gehört) ist das Schweizer Merel Quartett. Und das trotz einer offenbar sehr kurzfristigen Umbesetzung; es sei denn, der im Programmheft angekündigte zweite Geiger hat sich seit Aufnahme des Quartett-Fotos doch stark verändert (kein Bart mehr, dafür herrliche weibliche Rundungen). Alfred Brendel gibt eine kleine Einführung zu Beethovens Streichquartett B-Dur op. 130, das hier nicht mit dem nachkomponierten leichteren Finale, sondern der ursprünglichen Großen Fuge erklingt. Das Quartett lässt er einige Motive anspielen, um es dann zum Ausruhen noch einmal vor die Tür zu schicken und, als der Vortrag beendet ist, persönlich wieder auf die Bühne zu holen. Eine fast rührende Vorsorge, deren Berechtigung das Merel Quartett dann beweist: Wow, so witzig kann später Beethoven sein! Komik entsteht ja aus Kontrasten, zwischen hohem Tanz und Bauernstampfe, zwischen äußerster Innigkeit und innerlicher Verschmitztheit. Und diese gefürchtete Große Fuge ist doch eigentlich ein phänomenaler Sternspritzer! Wenn man sie so spielt wie Merel.

Die Sterne spritzen auch (aber auf ganz andere Weise: so, dass das Weltall untergeht) zum Abschluss des Abends, wenn das Quatuor Ebène gemeinsam mit Alfred Brendels Sohn, dem Cellisten Adrian Brendel, das Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert spielt. Der ist einen Kopf größer als die Ebènes, aber das ist auch das einzige Missverhältnis.
Brendel senior führt erneut mit einem Essay ein, diesmal mit Beispielen am Steinway-Flügel. Dürfen wir ihn also sogar noch einmal Klavier spielen hören! Und singen, denn sein stilles Mitsummen transzendiert der Mikroport ins Große. Skurril, informativ und tief berührend ist das. Und dann dieses Quintett, von den Ebènes und Brendel junior auf permanenter Stuhlkante gespielt. Extrem kommunikativ, extrem präzise, extrem ausdrucksvoll: Diese Musik ist wirklich das Letzte vom Letzten, das Höchste vom Höchsten. Wenn Brendel und Merlin ihre Celli in bewegender musikalischer Homophilie miteinander singen lassen, dann hält der ganze Saal die Luft an. Knapp 50 Minuten dauert die Ewigkeit. Das Wunder geschieht, kein Räuspern, kein Flüstern, kein Schuhsohlenquietschen, sondern vollkommene Stille. Die stört nicht mal der Brachialhuster im Adagio und später das unvermeidliche Handy.
Die Brendel-Hommage dauert noch bis zum 7. Mai. Unter anderem mit Schöner Müllerin, Alter Musik, Kammermusik, den Wiener Philharmonikern und einem reizvollen Ivàn-Fischer-Programm.
Schöne Tagesspiegelkritik zu den letzten beiden Quartetten.
