Hohe Besuche beim Musikfest in der Philharmonie — Valery Gergiev kommt mit seinen Münchner Philharmonikern, Simon Rattle mit seinem (fühlt sich immer noch seltsam an, das zu schreiben) London Symphony Orchestra. Wachsam wägend wuppen sie geWaltiges, ein Erst- und ein Letzthauptwerk zweier solitärer Komponisten: Die Londoner haben Messiaens kurz vor seinem Tod komponierte Éclairs sur L’Au-Delà dabei, die den Vorhang zur Ewigkeit lupfen (mehr dazu unten). Die Münchner Philharmoniker beginnen mit Alfred Schnittkes 1. Sinfonie, die aus den 1970ern stammt, aber ein paar Jahrhunderte Musikgeschichte verquirlt und den Hörer so auf einen fernen Bewusstseinsplaneten verraumschifft.
Schnittkes ungeheuerliches Ding wurde 1974 in Gorki uraufgeführt (wie Nischni Nowgorod damals hieß), im Jahr der Solschenizyn-Ausweisung und überhaupt allgemeiner Eiszeit. Eine spezielle Konstellation muss es gewesen sein, die das ermöglichte; und bis ans unselige Ende der Sowjetunion gabs kein zweites Mal für die Erste von Schnittke, der 1990 nach Hamburg zog und dort, wie man es in Hamburg halt tut, bald starb. In den Sechzigern aber hatte Schnittke sich nach einigen unvermeidlichen Mannhaftigkeitsproben der seriellen Selbstverleugnung entschlossen, aus dem überfüllten Zug auszusteigen.
A good candidate for the wildest piece of music ever written, nennt Alex Ross Schnittkes Erste, und wenn mans in der Philharmonie erlebt, stimmt man sofort zu: Wie aus dem Nichts beginnt auf dem noch leeren Podium ein Musiker mit roten Hämmern Röhrenglocken zu bearbeiten, eine Trompete kommt herein, dann der Konzertmeister mit seiner Geige, und schließlich wuselt nach und nach in fiedelndem und dudelndem und röhrendem Tohuwabohu die gesamte Überhundertschaft der Münchner Philharmoniker herein. Es folgt ein wüstes Spektakel, aber eben voller stiller und konzentrierter Phasen: bald ein Bachchoral, bald ein virtuoses Posaunensolo, dem der Rest des Orchesters zurecht applaudiert.
Die Dramaturgie erschließt sich kaum, man ahnt höchstens aufgrund der gerade vorherrschenden Tempi, in welchem der vier Sätze man sich gerade befindet. Aber die Ereignisdichte lässt die Aufmerksamkeit über eine Stunde lang lodern. Auf eine Art Fliegeralarm folgt der finale C-Dur-Triumph aus Beethovens Fünfter, ein Barockconcerto begegnet einer mahlerschen Es-Klarinette, es gibt Streichtrio-Fetzen und ein Jazzsolo von Klavier, Kontrabass, E-Gitarre und soghafte aleatorische Bläserwellen, überhaupt etwelche erhabene Steigerungen und mystische Ruheperioden. Oder ein Jüngstes Gericht mit beizenden Bläsern und dräuender Rache-Orgel des Heiligen Doktor Fu Man-Chu. Kurz, man wähnt sich in der Bewusstseins-Ursuppe des Planeten Solaris, wo alle Zeit zugleich ist, und es ist unglaublich großartig.
Und mittendrin, am Pult des alten Celi-Orchesters Müncher Philharmoniker, dieser eigenartige Valery Gergiev und sein Dirigierstil Zitteraal mit Zahnstocher. Die Schnittke-Partitur ist so hoch wie ein Vorschulkind, Gergiev stemmt sie am Ende im Beifallssturm in die Höhe. Und das ist es, was man in der ganzen Aufführung gespürt hat: mehr als Respekt, nämlich wahre Hingabe.
An Simon Rattles Hingabe an geliebte Werke besteht sowieso kein Zweifel. Nostalgische Stimmung in der Philharmonie, obwohl Rattle doch gar nicht richtig weg ist aus Berlin, sondern regelmäßig zu erleben sein wird. Am Ende seines Konzerts mit dem London Symphony Orchestra (das viel mehr ist als die Starwars- und Indianajones-Truppe) gibt es exuberanten Jubel trotz fordernden Programms. Und ob hier ein Rattle-Konzert nicht ganz ausverkauft ist oder aber ein Konzert mit zwei nach 1990 entstandenen Werken fast ausverkauft, das ist eine Frage der Sichtweise.
Tja, die Éclairs sur L’Au-Delà, komponiert 1992 im Angesicht des bevorstehenden Sterbens. Doch eine eher verängstigende Jenseits-Vision, wenn man nicht gerade Olivier Messiaen ist, sondern bloß der Konzertgänger. Sollte im Paradies wirklich die ganze Zeit die Triangel bimmeln wie im elften und letzten Satz Le Christ, lumière du Paradis, dann möchte er lieber in die Hölle.
Aber imposant ist das natürlich, klanglich hervorragend organisiert unter Rattle sowieso, und manchmal sind die bedenklichen psychopharmazeutischen Wirkungen dieser Musik auch fantastisch. Etwa in Le Sept Anges aux sept trompettes, einer berauschenden Mischung aus Posaunen, mächtigen Gongschlägen und den gestrengen Holzpeitschenschlägen einer apokalyptischen Domina. Hier monumentale Bläserchoräle, dort sehnende Streicher; manchmal so kitschig, dass man fürchtet, einem könnte das Gehirn zu den Ohren rausfließen. Astrologie und Epiphanie kreuz und quer, und natürlich auch Ornithologie: Wenn sich die Vögel in Plusieurs oiseaux des arbres de Vie im Saal verteilen, bekommen die zahllosen Holzbläser eine geradezu schmerzhafte Präsenz, etwa so, wie man sich den Regenwald zur Paarungszeit vorstellt. Wie selbst bei diesem späten Messiaen die göttliche Liebe manchmal fast eine Art Softporno-Atmosphäre hat, ein knisterndes Klangschaumbad. Und dann wieder staunt man über das fast kindliche Beharren darauf, die Größe Gottes mit Großen Klängen anzubilden.
In mancher Hinsicht zu ähnlich ist das vorhergehende Werk, Hans Abrahamsens let me tell you von 2013, eine Art geheimnisvoll tastender Ophelia-Kantate (die aber im Schnee endet, nicht mit Leiche im Wasser). Daran ist zwar nichts Monumentales, aber ebenfalls einiges transzendierendes Klimbim; so dass man am Ende des Konzerts wirklich duselig ist und nur ungern eine LSD-Blutprobe abgäbe.
Aber schön ist das, meine Güte! Andris Nelsons hat es 2013 bei den Berliner Philharmonikern uraufgeführt (damals folgte Brahms‘ Vierte). Schon damals sang die Sopranistin Barbara Hannigan, auswendig und hoch engagiert, mit seelischer Inbrunst und karikaturesk ausgestelltem Vibrato im O but memory und steilen Intervallsprüngen. An diesem Londoner Abend fällt aber auch auf, dass man vor allem am Anfang eher Vokalisen mit gelegentlichen t’s hört und einige Höhen mühsam nach und nach erklommen werden. Und überhaupt wirkt Abrahamsens fließender, farbiger, ja hypnotisierender Orchestersatz reizvoller als der Vokalpart. Beim Vers and turned me to light entsteht ein mächtiges Gesamtklingeln des Orchesters; wie gesagt, LSD. Der dritte Teil des Werks widmet sich, nach dem how it was und dem how it is, dem how it will be, ein süßleises Schibbern, ganz herrlich; für ein paar Minuten zumindest, nicht unbedingt in alle Ewigkeit.
Valery Gergiev seinerseits ließ mit den Münchnern der enormen Schnittke-Sache noch ein enormes Werk folgen, und zwar Anton Bruckners Sechste. Die musste nach einer frustrierend nachlässigen Bruckner-Neunten mit derselben Besetzung vor einem Jahr allerdings ohne den Konzertgänger stattfinden. Zumal die Schnittke-Eindrücke so gigantisch waren, dass nichts mehr darauf und dahinter passte. Aber wer weiß, vielleicht war der Bruckner ja dieses Jahr ganz hervorragend.

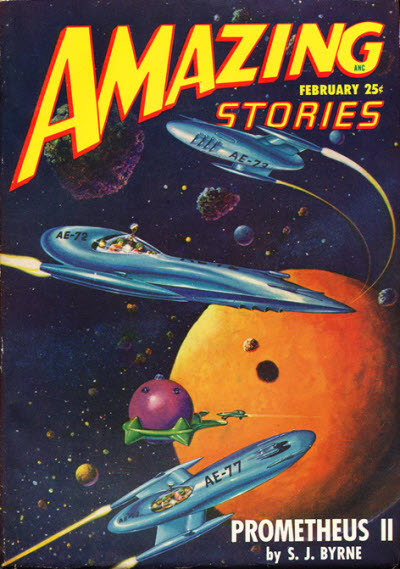



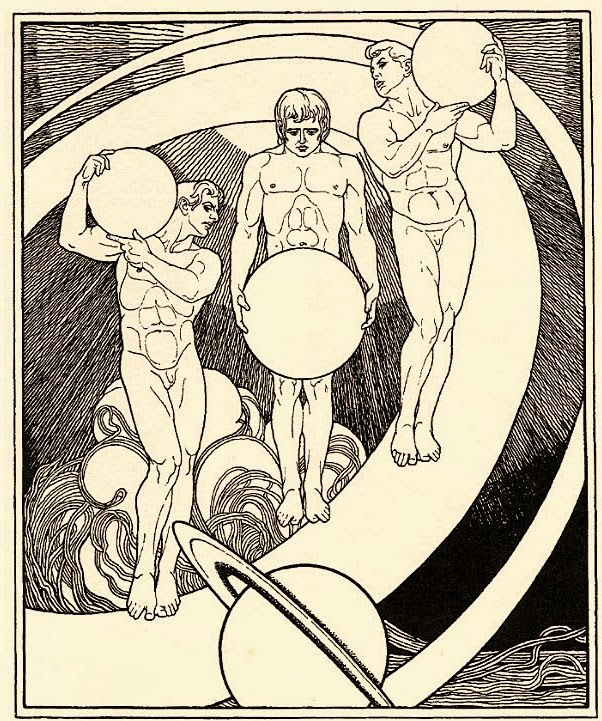
Vielleicht war der Bruckner ganz hervorragend, ich weiss es nicht. Denn ich blieb nach der Pause noch lange vom Eindruck der Schnittke 1 gefangen, kaum in der Lage mich auf Anton einzulassen. Zudem die 6. eh nicht zum meinen Unverzichtbaren gehört.
Das Vorprogramm war einfach zu stark. Auf Schnittke eingegroovten Ohren schien Bruckner (subjektiv und an diesem Abend) etwas stumpf.
Manchmal gewinnt die Musik durch den Kontext (Sibelius 5 zB. letzte Woche), manchmal nicht.
Ganz klar für mich bis jetzt der Höhepunkt dieses Musikfestes bzw. was ich davon mitbekommen habe. Zusammen mit der Neuwirth, das ist eine Gute.
Ich mag die Sechste sehr gern, aber ich denke, es wäre mir ähnlich gegangen wie Ihnen. Ich stimme Ihnen zu, das war ein Höhepunkt. Und schön, dass Sie auch Olga Neuwirth schätzen!