Am Konzertgänger ist ein gutbetuchter Rentier verlorengegangen: Er wüsste sich Übleres vorzustellen als den lieben Sommer lang den Musikern seines Herzens nachzureisen. Aber manchmal tun sich auch im turbulenten Familienurlaub Gelegenheiten auf. Zum einen, weil im schönen Pustertal bemerkenswert viele schöne Konzerte stattfinden, zum anderen, weil beim Festival Bozen neben wunderbaren jungen Ensembles wie dem Orchester der Gustav Mahler Akademie oder dem Theresia Youth Baroque Orchestra auch Musiker von Weltrang wie Jordi Savall, Christian Gerhaher und Grigory Sokolov sich die Klinke in die Hand geben.
Schlagwort-Archive: Robert Schumann
4.6.2016 – Seufzend: Mandelring Quartett spielt Viktor Ullmann, Mozart, Schumann
 Nicht Jagdquartett, sondern Vogelzwitscherquartett sollte Wolfgang Amadeus Mozarts idyllisches Streichquartett B-Dur KV 458 heißen, wenn es denn einen Beinamen haben soll: In seinen buchfinkhaften Trillerketten bildet sich der federleichte Schwung ab, mit dem das Mandelring Quartett im Kammermusiksaal das letzte Konzert seiner Berliner Saison eröffnet. (Sehr passend gibt es dann am Ende Adagio und Finale aus Haydns Lerchenquartett als Zugabe.)
Nicht Jagdquartett, sondern Vogelzwitscherquartett sollte Wolfgang Amadeus Mozarts idyllisches Streichquartett B-Dur KV 458 heißen, wenn es denn einen Beinamen haben soll: In seinen buchfinkhaften Trillerketten bildet sich der federleichte Schwung ab, mit dem das Mandelring Quartett im Kammermusiksaal das letzte Konzert seiner Berliner Saison eröffnet. (Sehr passend gibt es dann am Ende Adagio und Finale aus Haydns Lerchenquartett als Zugabe.)
30.5.2016 – Beginnend: Maurizio Pollini spielt Schönberg, Schumann, Chopin
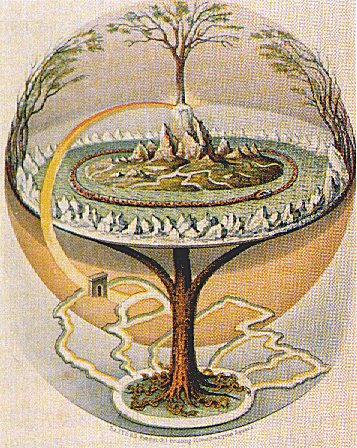 Altmeister-Klavierabend im Zeichen des beginnenden Lebens: Im dritten Satz der Fantasie C-Dur von Robert Schumann schreit ein erwachendes Baby. Im Mittelteil des ersten Scherzos von Frédéric Chopin wiegt das polnische Weihnachtslied Schlaf, mein Jesulein, schlaf. Und als dritte und letzte Zugabe spielt Maurizio Pollini in der Philharmonie Chopins Berceuse Des-Dur op. 57, ohne jede Süßlichkeit, sondern glasklar und hellwach.
Altmeister-Klavierabend im Zeichen des beginnenden Lebens: Im dritten Satz der Fantasie C-Dur von Robert Schumann schreit ein erwachendes Baby. Im Mittelteil des ersten Scherzos von Frédéric Chopin wiegt das polnische Weihnachtslied Schlaf, mein Jesulein, schlaf. Und als dritte und letzte Zugabe spielt Maurizio Pollini in der Philharmonie Chopins Berceuse Des-Dur op. 57, ohne jede Süßlichkeit, sondern glasklar und hellwach.
Das muss auch die Toten freuen, einem von ihnen ist das Eröffnungsstück gewidmet: In memoriam Pierre Boulez (der Name im Programmheft schmählich falsch geschrieben, Boulez hätte sich hoffentlich amüsiert) spielt Pollini Arnold Schönbergs Sechs kleine Klavierstücke op. 19 von 1911. Ein Teil des Publikums ist da noch im Plaudermodus, so dass ihm entgeht, wie konzentriert und verinnerlicht Pollini diese zarten Miniaturen spielt. Im Großen Saal der Philharmonie wirkt das, als schwebten winzige Perlen durchs unendliche Weltall mit seinen toten Steinen und Meteoritenhageln.
Wie ein Schauer aus Weltraumschrott ist der gutgemeinte, aber voreilige Applaus, mit dem einige Hörer das langsam getragene, durchweg leise zu haltende Finale von Robert Schumanns Fantasie C-Dur op. 17 von den beiden vorhergehenden Sätzen grob abschneiden. Doch den Sternenkranz, in dem Pollini über 12/8-Weben den abgedunkelten Klang der Melodie magisch lichtet, lässt dieser Fauxpas umso jenseitiger tönen. Dass dann ein irdisches Baby hineinschallt, hat im Finale einer so uferlosen Liebeserklärung, wie Schumann sie mit der Fantasie für Clara schrieb, eine gewisse Richtigkeit: eine höhere Form der Störung, die regelrecht zu Herzen geht.  Gerade weil man weiß, wie es dieser großen Liebe in der kleinen Wirklichkeit erging.
Gerade weil man weiß, wie es dieser großen Liebe in der kleinen Wirklichkeit erging.
Den schmerzlichen, eindringlichen ersten Satz spielte Pollini zuvor mit großer Emotion, die aus sachlicher, runder Phrasierung entstand. Auch wenn manches Detail etwas undeutlich wirkte und Pollinis Läufe (wie schon in Schumanns Allegro h-Moll op. 8) nicht mehr so perfekt sein mögen wie einst, scheint er nie die Versuchung zu jener Langsamkeit zu spüren, aus der Grigory Sokolov, der die Fantasie kürzlich am selben Ort spielte, seine äußerste Klarheit gewinnt.
Wie im Schlussgesang der Fantasie in der einzelnen Phrase, so öffnet sich Pollinis Klang insgesamt im Lauf des Abends, weg vom anfänglich leicht Verrauschten, Nervösen. Und so wie Pollini vornübergebeugt zum Flügel eilt, der Kopf schneller als die Füße, so stürzt er sich kopfüber in die durchrüttelnden Kaskaden von Frédéric Chopins Scherzo Nr. 1 h-Moll op. 20. Wo die Hände, obwohl Pollini beim Tempo keinen Kompromiss eingeht, dem Kopf zu folgen verstehen: Urväter Weisheit weiß ja, dass Pollini schon seit Erschaffung der Welt nach der Pause immer besser wurde. Aber die pianistische Übersicht und manuelle Kontrolle des 74jährigen in den jähen Entfesselungen dieses Stückes verblüffen trotzdem. Und das Wiegenlied fürs Jesulein mit seinen glöckchenartigen Nachschlägen könnte in diesem noch immer meisterlichen Tumult nicht herzzerreißender wirken.
Die Brillanz, zu der Pollini schließlich (nach vier klangschönen, in jedem Bogen hochdifferenzierten Nocturnes op. 55 und 62) im abschließenden Scherzo Nr. 3 cis-Moll op. 39 gelangt, hätte man bei aller vorauseilenden Bewunderung zu Beginn dieses Klavierabends nie und nimmer erwartet. Ein paar falsche Töne mag es geben, aber nichts zerfällt und nichts verschwimmt: Verklärung durch Genauigkeit in diesem schönsten aller Chopin-Scherzi.
Drei Zugaben: die c-Moll-Etüde op. 10, Nr. 12, die Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23 und die erwähnte Berceuse Des-Dur op. 57.
Nach dem Konzert traut man seinen Augen kaum, Pollini steigt (ohne sich am Treppengeländer festzuhalten!) ins Foyer herab, um dort – kein Mensch bei Trost würde das von ihm verlangen – am CD-Stand Autogramme zu schreiben. Rührende Hingabe nicht nur an die Musik, sondern auch ans treue Publikum, wie unzulänglich es sich auch betragen mag. Man kann Maurizio Pollini nicht nicht bewundern.
29.5.2016 – Rar: Christoph Eschenbach und Iskandar Widjaja beim DSO
Raritätensonntag in der Philharmonie: Nachmittags spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester, nach einem Gezi-Park-Klavierkonzert von Fazil Say, Alexander Zemlinskys Seejungfrau (der Konzertgänger war familiär verhindert), abends das Deutsche Symphonieorchester ein Violinkonzert und eine Symphonie, die kein Schwein kennt. Das ist schon mal ein Verdienst von Christoph Eschenbach.
Ein zweites Verdienst ist es, dass er einen vielversprechenden jungen Solisten mitbringt, sogar einen echten Berliner Jungen: Iskandar Widjaja. Einige Fans sind zu sichten und zu hören (in Indonesien scheint er schon eine Berühmtheit zu sein), vereinzelte Jubelrufe bereits, als er das Podium betritt. Trotz Starpotenzial strahlt er eine sympathische Schüchternheit aus.  Henryk Wieniawskis Violinkonzert d-Moll (1862/1870) spielt er mit gesteigertem Vibrato und warmem Klang, was bei diesem wohlklingenden Virtuosenvehikel ganz richtig ist. Trotz großer Geste scheinen Widjaja noch mehr die stillen, gefühlvollen Töne zu liegen, wie er im zweiten Satz mit langem Strich beweist. (Sein, durchaus angenehmer und der Konzentration förderlicher, leiser Ton mag auch mit dem Instrument von Geissenhof zu tun haben.) Das Zingara-Finale dagegen feurig, rasant und tänzerisch, die Füße dicht vor dem Moonwalk.
Henryk Wieniawskis Violinkonzert d-Moll (1862/1870) spielt er mit gesteigertem Vibrato und warmem Klang, was bei diesem wohlklingenden Virtuosenvehikel ganz richtig ist. Trotz großer Geste scheinen Widjaja noch mehr die stillen, gefühlvollen Töne zu liegen, wie er im zweiten Satz mit langem Strich beweist. (Sein, durchaus angenehmer und der Konzentration förderlicher, leiser Ton mag auch mit dem Instrument von Geissenhof zu tun haben.) Das Zingara-Finale dagegen feurig, rasant und tänzerisch, die Füße dicht vor dem Moonwalk.
In Robert Schumanns ebenfalls nicht hyperkomplex komponierter, aber sehr rührend zwischen äußerlicher Pracht und äußerster Zerbrechlichkeit changierender Fantasie für Violine und Orchester C-Dur op. 131 (1853, kurz vor Schumanns Zusammenbruch) kommen Widjajas leise Qualitäten noch besser zur Geltung, dank Fritz Kreislers (den Schumannfreund nicht nur erfreuender) Überarbeitung von 1937 auch die virtuosen Fähigkeiten.
Gerahmt werden die beiden Violinstücke von einem hyperaktiven, knalligen, teils ohrenbetäubenden Till Eulenspiegel von Richard Strauss zu Beginn des Konzerts und einer sehr lohnenden Seltenheit am Schluss, die sich ein Teil der indonesischen Fans leider nicht mehr anhört: Paul Hindemiths Symphonie in Es, 1940 im amerikanischen Exil komponiert. Hörbar besser geprobt als Strauss (bei dem die Orchestergruppen für sich durchaus überzeugten, allen voran die Hörner), herrscht bei Hindemith statt schillernder Klangfarben eine spröde, archaische Begeisterung, die nach erstem Befremden einen enormen Sog entfaltet: Härte ist hier eine Tugend – zumal wenn sie so perfekt austariert klingt wie beim DSO. Der große zweite Satz weitet sich nach fast bluesartigem Trompeten-Intro monumental wie ein Brucknersatz. Außerordentlich die flirrenden Mittelinseln des dritten und der sardonisch rumpelnde Witz des vierten Satzes.
Überraschend überzeugendes Plädoyer für ein kaum mehr gespieltes Werk. Man sollte ab sofort jede 7. Aufführung von Schostakowitschs Fünfter durch Hindemiths Es-Symphonie ersetzen.
Nachtrag: Die Geigenlehrerin der Tochter des Konzertgängers weist darauf hin, dass vielleicht kein Schwein, aber jeder gute Geiger das Wieniawski-Konzert kennt.
27.5.2016 – Klavierfestival (4): Sophie Pacini spielt Chopin, Liszt und Schumann
Das Konzert dieser vielversprechenden Pianistin beginnt unter keinem guten Stern: Weil rund um den Gendarmenmarkt Stau herrscht, fängt es rücksichtsvollerweise zehn Minuten später an – was für den ungeduldigen Sitznachbarn des Konzertgängers offenbar schon eine Impertinenz ist. Als die junge Deutsch-Italienerin Sophie Pacini sich an den Flügel im Kleinen Saal des Konzerthauses setzt, bumpern Pauken aus dem Großen Saal herüber, wo die Zauberflöte gespielt wird (da geht der Konzertgänger am Samstag mit tutta la famiglia hin).  Und in den ersten Takten von Frédéric Chopins Nocturne b-Moll op. 9, 1 bimmelt, fast hat man darauf gewartet, ein Handy.
Und in den ersten Takten von Frédéric Chopins Nocturne b-Moll op. 9, 1 bimmelt, fast hat man darauf gewartet, ein Handy.
Pacini ist natürlich ganz Profi und lässt sich nichts anmerken. Sie spielt dieses und das folgende Nocturne Des-Dur op. 27,2 bemerkenswert unsüßlich, unsentimental, unweichlich, unverträumt, vielmehr sehr deutlich und energiegeladen, dabei dunkel getönt. Die Töne im Diskant tröpfeln und perlen nicht klischeehaft, sondern verbinden sich zu klaren, ja dramatischen Linien. Man versteht, warum Martha Argerich diese junge Pianistin unter ihre Fittiche genommen hat.
Allerdings fällt bereits hier auf, was den ganzen Abend prägen wird: eine sehr hohe Grundlautstärke. Ob Pacini den Kleinen Saal oder den Yamaha-Flügel falsch einschätzt oder das Publikum (eventuell ja zu Recht) für schwerhörig hält? Jedenfalls wird der Bass manchmal so dröhnend, dass es, um im Nocturne-Bild zu bleiben, an nächtliche Ruhestörung grenzt. In Chopins Scherzo Nr. 2 b-Moll op. 31 (statt der angekündigten Polonaise-Fantasie As-Dur) geht das gut, wenn das energiegeladen fragende Rollen auf wuchtige Entladungen trifft. Auf höchstem technischen Niveau ist es ohnehin.
Trotzdem freut man sich, mit den Consolations 1 – 3 eher innerliche, fast bescheidene Stücke von Franz Liszt zu hören. Aber das dicke Ende folgt auf dem Fuße: Die Tannhäuser-Ouvertüre ist eher eine Klavierversion als eine Opernparaphrase, in der kompositorische Funken sprühen würden. Sehr reizvoll allerdings die Auf- und Abwärtsläufe im Bacchanal. Pacini spielt das beeindruckend, gewaltig, steigert den Pilgerchor immer weiter, wenn man bereits denkt, noch lauter wird es nun wirklich nicht gehen. Aber der ungeheurliche Aufwand für so ein musikalisches Nichts hat auch etwas Bedauerliches, man bräuchte gleich wieder consolation. Wenn es nach dem Konzertgänger ginge, sollte Pacini sich diese Nummer für gutdotierte Einladungen zu Wagnervereinsjahrestreffen aufheben. (Gut allerdings, dass Kultursenator Tim Renner nicht in klassische Konzerte geht; er könnte sonst auf die Idee kommen, ein Opernorchester abzuschaffen und dafür Sophie Pacini anzustellen.)
 Robert Schumanns Carnaval ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Sehr witzig scheint Pacini Schumann allerdings nicht zu finden. Natürlich ist kein Pianist zum Lächeln verpflichtet, aber die Forte-Kontraste im Pierrot etwa sind so korrekt ausbuchstabiert, dass die Komik, die zur Bizarrerie gehört, verlorengeht. Stattdessen betont Pacini (was natürlich legitim ist) das Dramatische und Zerrissene dieser vorbeifliegenden Charaktere und Gestalten.
Robert Schumanns Carnaval ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Sehr witzig scheint Pacini Schumann allerdings nicht zu finden. Natürlich ist kein Pianist zum Lächeln verpflichtet, aber die Forte-Kontraste im Pierrot etwa sind so korrekt ausbuchstabiert, dass die Komik, die zur Bizarrerie gehört, verlorengeht. Stattdessen betont Pacini (was natürlich legitim ist) das Dramatische und Zerrissene dieser vorbeifliegenden Charaktere und Gestalten.
Natürlich ist das brillant. Pacini lässt viele Stücke ineinander übereinandergehen, was sehr überzeugend ist. Aber mancher Hörer wird eine gewisse Leichtigkeit vermissen. Es wird auch wieder arg dröhnend, nicht erst wo es sich schwer vermeiden lässt, etwa im finalen Davidsbündler-Marsch; wobei selbst hier vorstellbar wäre, die komische Seite stärker hervorzukehren (ein Marsch im 3/4-Takt!).
Man würde sich wünschen, diese hochbegabte Pianistin würde irgendetwas Verrücktes oder Falsches tun. Und vor allem leiser spielen. Die Pegelsau dieses Rezitals kann sie ja wieder rauslassen, wenn sie dereinst im Großen Saal der Philharmonie spielen wird. Denn dass sie ihren Weg gehen wird, steht außer Frage; in einem knappen Jahr gibt sie ein Rezital im Rahmen der Meister-Klavierabende von Adler, da steht sie in einer Reihe u.a. mit Ivo Pogorelich, Elena Bashkirova und Grigory Sokolov.
12.5.2016 – Durchaus fantastisch: Grigory Sokolov spielt Schumann, Chopin und sechs Zugaben
 Ein Tick Aura mag verloren sein, seit Grigory Lipmanowitsch Sokolov wieder die Veröffentlichung von Aufnahmen zulässt. Konzertmitschnitte natürlich, keine Studioaufnahmen! Dennoch, man kann Sokolov jetzt ins Regal stellen oder gar, horribile dictu, downloaden oder streamen. Nachhören allerdings konnte man ihn in gewisser Weise schon früher: Der Konzertgänger besuchte 2014 Sokolovs reines Chopinprogramm zweimal, im Frühling in Berlin und im Sommer in Bozen, und höre, da war nicht der geringste Unterschied.
Ein Tick Aura mag verloren sein, seit Grigory Lipmanowitsch Sokolov wieder die Veröffentlichung von Aufnahmen zulässt. Konzertmitschnitte natürlich, keine Studioaufnahmen! Dennoch, man kann Sokolov jetzt ins Regal stellen oder gar, horribile dictu, downloaden oder streamen. Nachhören allerdings konnte man ihn in gewisser Weise schon früher: Der Konzertgänger besuchte 2014 Sokolovs reines Chopinprogramm zweimal, im Frühling in Berlin und im Sommer in Bozen, und höre, da war nicht der geringste Unterschied.
Die auffälligste Äußerlichkeit, die Sokolovs Epiphanie 2016 von der Epiphanie 2015 unterscheidet: Der Steinway-Flügel steht diesmal näher am Rand des Podiums der Philharmonie. Und war Sokolovs Anzughose schon immer so kurz? Er spielt in sich versunken wie eh und je: im Dämmerlicht, das Gesicht im Dunkeln, Lichtschein nur auf Händen und Tasten. Man ist nicht sicher, ob Grigory Lipmanowitsch Sokolov weiß, in welcher Stadt, welchem Jahr, welchem Universum er sich gerade befindet. Auch das Husten im Publikum scheint ihn nicht zu tangieren, nicht mal das elende Hatschi in Block D links, wo irgendwer Niespulver mitgebracht zu haben scheint.
 Nur zweimal, jenseits von Sokolovs rein mechanischen Verbeugungen, kommt es zu sichtbaren Interaktionen mit dem Publikum. Es sind zwei peinliche Momente: Einmal klatscht das Publikum in Schumanns Fantasie C-Dur hinein, nach dem 1. Satz, und noch einmal nach Chopins Nocturnes, als Sokolov direkt mit der b-Moll-Sonate beginnen will. Er nimmt die Hände von den Tasten, steht auf, verbeugt sich mechanisch, spielt weiter.
Nur zweimal, jenseits von Sokolovs rein mechanischen Verbeugungen, kommt es zu sichtbaren Interaktionen mit dem Publikum. Es sind zwei peinliche Momente: Einmal klatscht das Publikum in Schumanns Fantasie C-Dur hinein, nach dem 1. Satz, und noch einmal nach Chopins Nocturnes, als Sokolov direkt mit der b-Moll-Sonate beginnen will. Er nimmt die Hände von den Tasten, steht auf, verbeugt sich mechanisch, spielt weiter.
„Ach! Vor einigen Jahren, da war der Sokolov ein Geheimtipp! Aber ich war damals schon da!“
Sokolovs Ruf ist so groß geworden, dass offenbar auch Besucher da sind, die sonst niemals ein Klavierrezital besuchen. Was prinzipiell ja nur zu begrüßen ist. Klavierneulinge im allgemeinen erkennt man am Reinklatschen, Sokolov-Novizen im besonderen daran, dass sie schon nach der ersten oder zweiten Zugabe gehen oder nach der sechsten Zugabe weiterklatschen. (Wie überhaupt diese enthemmten Applausstürme unangemessen wirken, besser wäre würdig sachliche Zustimmung.)
Die wie immer sechs Zugaben A.D. 2016 also sind:
 1. Franz Schubert, Moment musical Nr. 2 As-Dur
1. Franz Schubert, Moment musical Nr. 2 As-Dur
2. Franz Schubert, Moment musical Nr. 3 f-Moll
3. Franz Schubert, Moment musical Nr.4 cis-Moll
4. eine Mazurka von Chopin (aber welche?)
5. Franz Schubert, Moment musical Nr.5 f-Moll
6. Franz Schubert, Moment musical Nr.6 As-Dur
Sie stehen am Ende eines langen Abends, denn Sokolov zelebriert auf einzigartige Weise die Plastizität des einzelnen Tons, was ausgesprochen langsame Tempi einschließt. In Robert Schumanns Arabeske C-Dur op. 18 modelliert er die Linke, wie leise sie auch fast durchgehend spielt, so deutlich, dass es unerhört ist. Im übrigen ist die Arabeske ein so intimes und poetisches Stück, dass sie im (zu) Großen Saal der Philharmonie grotesk verloren wirkt. Der zweite Satz von Schumanns Fantasie C-Dur op. 17 (nach der schmählichen Klatsch-Unterbrechung) ist eher für eine solche Bahnhofshalle geschrieben, wird aber bei Sokolov zwar laut, doch niemals dröhnend. In den gebremsten Passagen des Kopfsatzes Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen zerfällt die Musik fast, so extrem zerdehnt Sokolov Übergänge und Abschlüsse.  Umso heftiger aufwühlend klingt jedoch der immer wieder hochwogende Schmerzensgesang. Kritiker bemängeln bei solcher Gelegenheit gern, der große Bogen, die Idee des Werks drohe durch zu viel Liebe zum Detail verloren zu gehen. Der Konzertgänger bemängelt das nicht, im Gegenteil, soll denn ein großes Werk unter einer Idee zu fassen sein? Der große Bogen ist in der sich verzweigenden Komposition, welcher Sokolov selbstlos dient mit seinem klaren und überdeutlichen Anschlag: jeder Ton wie aus Porzellan. Der Konzertgänger hat das blasphemische Gefühl, im Vergleich hierzu sei etwa der große Swjatoslaw Richter (dem Sokolov an Expressivität nichts schuldig bleibt) über alle möglichen Stellen hinweggehuscht.
Umso heftiger aufwühlend klingt jedoch der immer wieder hochwogende Schmerzensgesang. Kritiker bemängeln bei solcher Gelegenheit gern, der große Bogen, die Idee des Werks drohe durch zu viel Liebe zum Detail verloren zu gehen. Der Konzertgänger bemängelt das nicht, im Gegenteil, soll denn ein großes Werk unter einer Idee zu fassen sein? Der große Bogen ist in der sich verzweigenden Komposition, welcher Sokolov selbstlos dient mit seinem klaren und überdeutlichen Anschlag: jeder Ton wie aus Porzellan. Der Konzertgänger hat das blasphemische Gefühl, im Vergleich hierzu sei etwa der große Swjatoslaw Richter (dem Sokolov an Expressivität nichts schuldig bleibt) über alle möglichen Stellen hinweggehuscht.
Die Struktur des Schumann-Teils wiederholt sich nach der Pause bei Frédéric Chopin: zuerst private, intime Musik, dann das emotional durchrüttelnde Großwerk eines poetischen Komponisten. In den beiden Nocturnes op. 32 ist die Linke schattenhaft leise, doch deutlich, die Rechte wiederum so plastisch, dass es schön und schmerzhaft zugleich ist, jeder Ton scheint ewig zu klingen. In der Sonate Nr. 2 b-Moll op. 35 auch schroffe, fast brachiale Klänge im Kopfsatz und im Trauermarsch, den Sokolov in der Wiederkehr des Themas dynamisch steigert und steigert, obwohl das kaum mehr möglich scheint: Geradezu gewalttätig wird der Hörer aus jedem Glück gerissen. Eben das, pures Glück auf Erden, hat er im Mittelteil und zuvor im ausufernden Trio des Scherzos erlebt. Und das bizarre Minutenfinale der Sonate spielt Sokolov so akkurat, dass es umso gespenstischer vorbeihuscht.
Fantastisch und leidenschaftlich. Nächste Sokolov-Epiphanie in Berlin: 29. März 2017.
15.4.2016 – Schumann plus: Mandelring Quartett und Ian Fountain im Kammermusiksaal
Der Fröhliche Landmann ist anno 2016 ein Jazzpianist: Der österreichische Komponist Paul Engel, dessen künstlerisches Wirken sich von einer frühen Rolle im Heimatfilm Die singenden Engel von Tirol bis zu Werken wie Korrelation und Metasinfonia erstreckt, hat ein Klavierquintett Hommage à Robert Schumann geschrieben, das man strukturell als Tondichtung Ein Romantikerleben bezeichnen könnte.  Am biografischen Schnürchen sind die sieben Abschnitte des Stücks aufgefädelt, von der Kindheit bis zur finalen Melancholie mit Wahn. Engels musikalische Sprache hat aber zum Glück gar nichts von symphonischer Dichtung, sondern ordnet jeder Station eine Klangsphäre zu, die auf musikalischen Assoziationen beruht, dem Album für die Jugend und den Davidsbündlertänzen etwa oder auch dem Violinkonzert des Hamburger Bewunderers Brahms.
Am biografischen Schnürchen sind die sieben Abschnitte des Stücks aufgefädelt, von der Kindheit bis zur finalen Melancholie mit Wahn. Engels musikalische Sprache hat aber zum Glück gar nichts von symphonischer Dichtung, sondern ordnet jeder Station eine Klangsphäre zu, die auf musikalischen Assoziationen beruht, dem Album für die Jugend und den Davidsbündlertänzen etwa oder auch dem Violinkonzert des Hamburger Bewunderers Brahms.
Ein noch größeres Glück ist es, dass Engel dem Zuhörer leidiges Zitate-Raten erspart (auch wenn manche Phrasen einen anspringen, wie anfangs der Fröhliche Landmann). Stattdessen dominieren freie poetische und jazzige Klänge diese Traumreise, insgesamt vielleicht etwas additiv, aber doch von so unmittelbar ansteckender Musikalität, dass auch die asiatische Umblattlerin des Pianisten mitwippt. Aus einer anderen Welt, einem Kosmos ohne Taktstriche scheint hingegen der Ur-Melos im Zentrum der Komposition herüberzutönen, der sich als einziger Abschnitt nicht auf ein konkretes Schumannstück bezieht. Stattdessen: Clara. Ein Wechselgesang der Streicher über unendlich andauernden Liegetönen und unaufhörlichem Pendeln des Klaviers, der an die beiden Louanges in Messiaens Quatuor pour la fin du temps erinnert, sich von diesem aber durch eine geradezu orgasmische Steigerung unterscheidet.
Der Pianist Ian Fountain gesellt sich an diesem Schumann gewidmeten Abend zum Mandelring Quartett im Kammermusiksaal. Nur abseits des Klaviers wirkt der hochaufgeschossene Engländer mit großer Brille und schlottrigem Sacko ungelenk. Sein Zusammenspiel mit dem Quartett ist so umsichtig und fein abgestuft, dass man sich wünscht, es möge ewig weitergehen. Schon im eröffnenden Allegro brillante von Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 werden trotz Kraft und Frische (Clara Schumann) innehaltende Momente von fast tschaikowskyhafter trauriger Schönheit hör- und spürbar, die den folgenden langsamen Satz dann ja völlig dominieren: das vereinzelte Seufzen (besonders eindrucksvoll die schmerzlichherb klingende Bratsche von Andreas Willwohl) und das gemeinsame Seufzen in den schwerelos aufsteigenden Inseln der Erinnerung – ein Triumph der perfekt abgestimmten Agogik des Quartetts und ihres Gastes. Irritierend fest wirkt danach der sichere Boden, auf dem die Sätze 3 und 4 sich bewegen. Und vielleicht kunstvoller und trotz der scheinbar schlichten Form elaborierter, aber bei weitem nicht so unmittelbar berührend ist das als Zugabe gespielte schöne Andante aus Brahms‘ Klavierquintett.
Ein Muster an Spielkultur war bereits Schumanns Streichquartett a-Moll op. 41,1, mit dem die Mandelrings noch ohne Gast den Abend eröffneten: Unsagbar sanft sinken sie in die Andante espressivo-Einleitung dieses Stücks hinein, in dem alles singt, jede Fuge wie ein Kanon klingt. Wunderschön das zum Zerreißen gespannte Adagio. Als im Presto-Finale, kurz vor Schluss, die rasanten Abwärtsläufe innehalten, die Welt stehenbleibt in atemlosem Schumannglück, erinnert nur ruchloses Handybimmeln den Hörer daran, dass er sich noch im Diesseits befindet.
Am 4.6. kann er es wieder verlassen, dann spielt das Mandelring Quartett unter dem Motto Genie und Wahnsinn Mozart, Ullmann und das 3. Quartett von Schumann.
Zum Konzert / Zum Mandelring Quartett / Zum Anfang des Blogs
22.2.2016 – Geist(er)reich: Piotr Anderszewski im Kammermusiksaal
Dieses Konzert hat kein Programm, sondern eine Form: das romantische Muster ABCBA. Zwei Partiten von Bach (A) rahmen drei geisterhafte Stücke, nämlich den Faschingsspuk Papillons und die Geistervariationen von Schumann (B) sowie Karol Szymanowskis mediterranen Homer-Tagtraum Métopes (C).
Ein sehr ähnliches Konzert hat der polnische Pianist Piotr Anderszewski bereits im November 2014 im Konzerthaus gespielt, damals war der Saal unbegreiflicherweise halbleer. Der Kammermusiksaal, der fast genauso viele Plätze hat, ist dagegen ausverkauft, was wohl kaum nur an der besseren Akustik liegen kann; denn richtig gut hört man ein Klavierrezital im Kammermusiksaal nur in den Blöcken A, D und E.
Dort allerdings entfaltet sich die romantische Aura auf vollkommene Weise; wem der wunderbare Francesco Piemontesi zu nüchtern schien, der ist bei Anderszewski bestens aufgehoben. Der Saal ist atmosphärisch verdunkelt, der wie immer schwarzgekleidete Anderszewski sitzt auf einem Stuhl, keinem Klavierschemel – Stimmungszauberei, doch ohne Weihrauch. In den hochstilisierten Tänzen von Johann Sebastians Bach Partita Nr. 6 e-Moll BWV 830 huschen die Schlüsse gespenstisch vorüber. Anderszewski bewirbt sich um keine Settecento-Originalklang-Medaille, stattdessen möchte man fast von Sfumato sprechen, wenn es nicht so nach Pedalmissbrauch klänge. Denn auch wo Anderszewski viel Pedal benutzt, etwa in der Sarabande, herrscht der Eindruck völliger Klarheit, ein durchsichtiger Klangnebel. Vor allem aber erklingen in diesem nichts verschleiernden Sfumato die klarsten Abstufungen, die man sich wünschen kann, jede Linie wird herausziseliert und farbig nuanciert. Umgekehrt bleiben auch durchaus wuchtige Klänge, etwa die Arpeggien in der eröffnenden Toccata, feinsinnig abgetönt. – Eine ebenso stilisierte Tanzsuite, nun aber aus romantischem Geist, sind Robert Schumanns Papillons op. 2, in denen die Walzer, Polonaisen usw einer Faschingsnacht aphoristisch vorbeiflattern. Mögen sich hartherzige Puristen an Anderszewskis Bach noch stoßen, kann es an seinem innigen Schumann keinen Zweifel geben. Der einzige Einwand des Konzertgängers richtet sich gegen den Komponisten selbst: Am Schluss hat Schumann ein paar Töne zu viel komponiert, die kurz vor Ultimo erklingenden sechs Glockenschläge im Diskant wären der vollkommene Schluss.
Spiegelbildlich die zweite Hälfte des Konzerts: erst Schumann, dann Bach. Schumanns zur Zeit seines Zusammenbruchs entstandenen „Geister-Variationen“ Es-Dur mögen keine große Variationenkunst wie etwa die Sinfonischen Etüden sein, es legen sich ja lediglich einige Tonnebel und -schwaden um das Thema; aber dieses letzte Thema ist nun mal zum Zerschmelzen schön, und wen die todtraurigen Geistervariationen nicht rühren, der hat kein Herz. Ohne Unterbrechung schließt Anderszewski Bachs Partita Nr. 1 B-Dur BWV 825 an, die nun klingt, als wollte Bach dem armen Schumann die Ruhe und den Frieden schenken, die dieser in unserer Welt nicht mehr erlangen konnte. Wenn in der abschließenden Gigue die Hände sich à la Scarlatti oder Rameau kunstvoll kreuzen, klingt das wie spielerische Erlösung.
 Dazwischen – und auf diese Weise dezent ins Zentrum des Konzerts gerückt – spielt Anderszewski die Métopes op. 29 von Karol Szymanowski. Wer Skrjabin oder Ravels Gaspard mag, wird auch diesen sonnendurchfluteten Tagtraum nach Homers Odyssee lieben. Tempelreliefs aus Selinunt inspirierten Szymanowski zu dem dreisätzigen Stück, das das Gegenteil von klassischem Bildungsstaub ist: die körperlichste Musik an diesem Abend. Sie erinnert nicht nur an die Antike, sondern auch an Zeiten, als Süditalien und Nordafrika noch das Sehnsuchtsland der verfemten bürgerlichen Homosexuellen Europas waren. Erst die Sirenen, dann Kalypso, schließlich Nausikaa: Diese sirrende, flirrende Musik ist ein einziges Locken; alle Sätze steigern sich und kulminieren in dreifacher Erlösung, die durchaus ejakulativ klingt.
Dazwischen – und auf diese Weise dezent ins Zentrum des Konzerts gerückt – spielt Anderszewski die Métopes op. 29 von Karol Szymanowski. Wer Skrjabin oder Ravels Gaspard mag, wird auch diesen sonnendurchfluteten Tagtraum nach Homers Odyssee lieben. Tempelreliefs aus Selinunt inspirierten Szymanowski zu dem dreisätzigen Stück, das das Gegenteil von klassischem Bildungsstaub ist: die körperlichste Musik an diesem Abend. Sie erinnert nicht nur an die Antike, sondern auch an Zeiten, als Süditalien und Nordafrika noch das Sehnsuchtsland der verfemten bürgerlichen Homosexuellen Europas waren. Erst die Sirenen, dann Kalypso, schließlich Nausikaa: Diese sirrende, flirrende Musik ist ein einziges Locken; alle Sätze steigern sich und kulminieren in dreifacher Erlösung, die durchaus ejakulativ klingt.
Ein be- und vergeisterndes geist(er)reiches Konzert, das der Stimmungszauberer Piotr Anderszewski mit drei Zugaben von Leoš Janáček beschließt.
Zum Konzert / Zum Anfang des Blogs
2. Oktober 2015 – Kohärent rauschhaft: Marek Janowski und das RSB spielen Debussy, Szymanowski und Schumann
Ist man ein Depp, wenn man bei den Nuages die Augen schließt und sich Wolken vorstellt? Vielleicht hat der Konzertgänger dieses Bedürfnis nicht wegen Debussy, sondern weil er auf dem Weg in die Philharmonie Schreckliches erlebt und erhört hat: eine heftig bumpernde Anfeierprobe am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit, vor dem Brandenburger Tor, das durch ein funkelndes Riesenrad verdeckt ist, Partystimmung at its worst, deutsches Dismaland. Da müssen sich Claude Debussys Trois Nocturnes (1897-99) erst den Weg zum geschändeten Gehör verschaffen.
In Nuages blähen sich keine impressionistisch verschwommenen Gebilde, sondern in allen Grautönen abgestufte Wolken am nächtlichen Himmel. Das Englischhorn spielt eine wichtige Rolle, und der Konzertgänger muss kurz die Augen öffnen, um dem ausgezeichneten Englischhornisten Thomas Herzog zuzusehen, der stets mit eigentümlich ausgestreckten Beinen bläst. Das Rundfunk-Sinfonieorchester skizziert die Linien dieser Musik so klar, dass die Wolken auch bei offenen Augen nicht flöten gehen. Im Anschluss gebietet Marek Janowski, als das Pausengehuste zu eskalieren droht, energisch den Einsatz der Fêtes: entfesselte Festmusik, wie man sie den Menschen vor dem Brandenburger Tor wünschte, mit viel Laut, aber auch geheimnisvollem Marschtanz-Wispern von Pauke, Harfe, gestopften Trompeten oder leisen Späßchen von Flöte und Tuba. Zum Abschluss summen die Sirènes von der Empore G Sonderplätze. Janowski regelt viel mit der Linken nach, es ist faszinierend zu hören, wie sein Orchester und die Damen des MDR-Rundfunkchors auf jeden Fingerzeig reagieren. Auch wenn das über zehnminütige Sirenengesumme nicht Debussys unermüdendste Komposition ist.
 Ziemlich eso klingt auch der Chor in Karol Szymanowskis 3. Symphonie B-Dur ‚Das Lied von der Nacht‘ (1914-16). Sie hat den ganz speziellen Szymanowski-Sound, der im unvergleichlich schönen Stabat Mater von 1926 gipfelt. Das Lied von der Nacht ist ein überwältigender Klangrausch, in dem man Gott und die Sterne und noch viel mehr sieht, tanzende Derwische und schöne Huris; eine musikalische Ekstase, deren Voraussetzung das ist, was Janowski in lustiger Sachlichkeit Herstellung der Orchesterkohäsion nennt. Die kammermusikalischen Inseln sind ebenso präzise wie der entgrenzte Taumel; mystisch, aber deutlich singt auch der russische Tenor Dmitry Korchak den vom Persischen ins Deutsche und dann ins Polnische übersetzten (!) mittelalterlichen Sufi-Text.
Ziemlich eso klingt auch der Chor in Karol Szymanowskis 3. Symphonie B-Dur ‚Das Lied von der Nacht‘ (1914-16). Sie hat den ganz speziellen Szymanowski-Sound, der im unvergleichlich schönen Stabat Mater von 1926 gipfelt. Das Lied von der Nacht ist ein überwältigender Klangrausch, in dem man Gott und die Sterne und noch viel mehr sieht, tanzende Derwische und schöne Huris; eine musikalische Ekstase, deren Voraussetzung das ist, was Janowski in lustiger Sachlichkeit Herstellung der Orchesterkohäsion nennt. Die kammermusikalischen Inseln sind ebenso präzise wie der entgrenzte Taumel; mystisch, aber deutlich singt auch der russische Tenor Dmitry Korchak den vom Persischen ins Deutsche und dann ins Polnische übersetzten (!) mittelalterlichen Sufi-Text.
Im November wird der Konzertgänger 40 Jahre alt und wünscht sich: einen Szymanowski-Zyklus in Berlin, inklusive der Oper Król Roger.
Robert Schumanns Symphonien hingegen würde der Konzertgänger, wäre er Dirigent, gewiss meiden. Janowski aber dirigiert sie mit diesem Orchester seit 2001 zum dreizehnten Mal. Irgendwas muss also dran sein. Vielleicht hat es mit Orchestererziehung zu tun. Dem Konzertgänger jedenfalls, bei aller Sympathie für Schumann und Liebe zu seiner Klaviermusik, erschließen sich diese Symphonien nicht.
Nicht mal durch eine zweifellos erstklassige Aufführung wie diese: Die 4. Symphonie d-Moll (revidierte Fassung, 1851) geht Janowski lebhaft an, ziemlich schnell und scharf akzentuiert. So treten die gesanglichen Abschnitte im Kopfsatz schön hervor. Der kreisende Leerlauf und Aktionismus der Symphonie bleibt trotzdem mühsam; ohne die herrlichen Violingirlanden in den Mittelteilen des zweiten (Solo von Rainer Wolter) und dritten Satzes würde der Konzertgänger sie kaum aushalten. Dann die Einleitung zum Finale: einer dieser verheißungsvollen Satzanfänge in Schumannsymphonien, ein großes Versprechen, doch dann… wieder das leere Kreisen.
So schlimm wie das Bumpern am Brandenburger Tor ist es aber nicht.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.