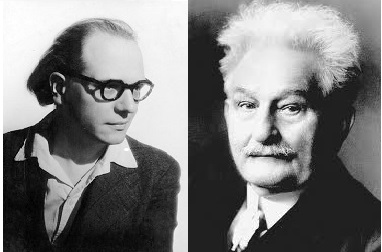 Olivier Messiaen und Leoš Janáček – kein ästhetisches Band verbindet diese beiden Komponisten, sondern einzig das organisatorische Ungeschick des Konzertgängers, der mit Schrecken feststellt, dass er am Sonntag Termine um 16 Uhr im Konzerthaus und um 18 Uhr in der Deutschen Oper hat.
Olivier Messiaen und Leoš Janáček – kein ästhetisches Band verbindet diese beiden Komponisten, sondern einzig das organisatorische Ungeschick des Konzertgängers, der mit Schrecken feststellt, dass er am Sonntag Termine um 16 Uhr im Konzerthaus und um 18 Uhr in der Deutschen Oper hat.
Von Messiaen in Mitte…
Die U2 fährt im 5-Minuten-Takt und braucht von Stadtmitte bis Deutsche Oper 16 Minuten. Aber auch das würde nichts nützen, gäbe es nicht im Konzerthaus diesmal nur ein einziges Werk, lang zwar, dafür ohne zeitraubende Pause: Olivier Messiaens wahrhaft monumentale Turangalîla-Symphonie (1946-49), zum Abschluss des Frankreich-Festivals, einer Woche mit nervigem PR-Sprech (oh la la, Savoir vivre am Gendarmenmarkt), dafür um so aufregenderer Musik von Couperin bis Mantovani.
Und einem kleinen Messiaen-Schwerpunkt: Eine Woche nach dem jenseitssüchtigen Quatuor pour la fin du Temps feiert das kosmische Diesseits in der Turangalîla-Symphonie, dem intensivsten Jubelschrei der Musikgeschichte, heftige Auferstehung. Iván Fischer lässt das Konzerthausorchester diesen durchgeknallt optimistischen Lebenshymnus mit packendem Enthusiasmus spielen. Der Spannungsbogen hält über 85 Minuten: von den Tristan-Inseln in den Chants d’amour über die fetzige Joie du sang des étoiles (dem Gesang des Sternenblutes, der klingt wie 20 Bigbands auf Speed oder einer noch unbekannten Substanz) und den vom Hörer innig ersehnten ruhigen Jardin du sommeil d’amour (dem Garten des Liebesschlafs, dessen Klangbild an Palestrinas verschollene Hawaii-Kompositionen gemahnt) bis zum großen Finale mit Urknall-Schlussakkord.
An wie vielen Turangalîla-Aufführungen mag Valérie Hartmann-Claverie, die die Ondes Martenot spielt, schon teilgenommen haben? Als einzige auf dem Podium musiziert sie auswendig. Der Pianist Roger Muraro hat einige Kadenzen zu spielen, die virtuoser sind als in so manchem Klavierkonzert. – Zum Konzert
… zu Janáček nach Charlottenburg
Vom kosmischen Schwung der Turangalîla-Symphonie beflügelt, dauert die U-Bahn-Fahrt nach Charlottenburg nur gefühlte 16 Sekunden. Dort wartet bereits die Frau des Konzertgängers, die bekennender Janáček- und Runnicles-Groupie ist.
Geradezu kosmische Kräfte entfacht auch der dramatische Genius von Leoš Janáček. Wenn Janáček ein kauziger mährischer Halbgott ist, dann ist Donald Runnicles sein spleeniger schottischer Halbprophet: ein sachlicher, aber umso überzeugenderer Anwalt dieses großartigen Komponisten, bereits in der herrlichen Jenůfa. Das Vorspiel der Sache Makropulos (1925/26) geht er mit einigen Volt mehr an als etwa die Wiener Philharmoniker in der schönen Mackerras-Aufnahme, die ganze Oper in einem Tempo, dass die Hörner sich im Finale auch mal überschlagen; trotzdem kein Kontrollverlust, eine packende Orchesterleistung. Runnicles hat das Orchester der Deutschen Oper derart auf Vordermann gebracht, dass es immer wieder die reine Freude ist.
Das Makropulos-Motiv erinnert den Konzertgänger umstandsbedingt an Messiaens absteigenden Akkorde-Leitfaden; erst recht wenn es sich am Ende des 2. Aktes härtet und stählt, als Emma Marty den armen Janek ins Unglück stürzt. Auch zwischen Messiaens indischen und Janáčeks mährischen Tabulaturen tun sich plötzlich Zusammenhänge auf: Aus winzigen Zellen entstehen gewaltige Wirbel. Wie Janáček seine kleinen Motive verzahnt, entwickelt einen ungeheuren Sog, die Musik scheint sich von Insel zu Insel zu bewegen, jedes Eiland besteht nur aus 3 bis 4 Tönen… und wie diese Musik dennoch oder gerade deshalb ans Herz geht!
Die Hauptfigur Emilia Marty ist eine Art weiblicher fliegender Holländer, ruhelos seit 337 Jahren; allerdings kein Seemann, sondern eine gefeierte Sängerin, die zunächst in einer Anwaltskanzlei auftaucht. Man würde sich auch nicht wundern, wenn Franz Kafka hereinspazierte, denn die Handlung nimmt von einem seit 100 Jahren laufenden undurchschaubaren Prozess ihren Ausgang.
Die Konversation der Protagonisten spiegelt sich in den Geistern der Vergangenheit. Die Regie von David Hermann (der bereits 2012 Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern auf die Bühne der DO brachte, in einer sehr zugänglichen Inszenierung, über die der Komponist hörbar die Nase rümpfte) ist manchmal etwas aufdringlich, etwa wenn zur Illustration eines erwähnten Selbstmords eine Pistole knallt und ein Statist tot umfällt oder wenn am Ende dem Publikum vorgehalten wird: EM = me. Aber insgesamt recht ordentlich, der wichtigste Einfall überzeugt: Emilia Marty überschreitet als einzige die unsichtbare Linie zwischen den Zeiten und wird begleitet von ihren eigenen Gespenstern, die da heißen Eileen MacGregor, Eugenia Montez, Ekaterina Myschkina, Elsa Müller… und eben Elina Makropoulos, Tochter des griechischen Alchemisten, der Kaiser Rudolf II. das ewige Leben schenken sollte, aber nur seiner eigenen Tochter endlose Wanderschaft bescherte.
Evelyn Herlitzius mag nicht so kalt wirken wie anno dunnemal Anja Silja, aber sie begeistert und bewegt in ihrer Darstellung der verzweifelten Frau, deren Fähigkeiten in Liebe und Kunst sich im Lauf der Jahrhunderte vervollkommnet, aber das Entscheidende verloren haben: die Seele. Herlitzius‘ dramatischer Sopran kann schneidend scharf klingen, aber auch ungeheuer seelenvoll, wie es sich bei Janáček, einem der großen Künstler des Mitleids, gehört – in der Verzweiflung regt sich ja eben doch die tote Seele. Gnadenlose Schärfe und rührende Weichheit verbinden sich beeindruckend im Pater hemon, dem griechischen Vaterunser, das EM im Finale kurz vor Ultimo anstimmt.
Die anderen Sänger wirken durchweg überzeugend, idiomatisch sehr gekonnt, so weit man das als Sprachunkundiger beurteilen kann. Seth Carico als Anwalt und Derek Welton als Baron stechen hervor, Ladislav Elgr klingt als Albert Gregor etwas gepresst, was zur gehetzten Figur passt, sehr eindringlich; als Idiot Hauk-Sendorf tritt der alte Wagner-Recke Robert Gambill auf.
Eine weitere Janáček-Sternstunde an der Deutschen Oper. In der nächsten Saison ist leider gar kein Janáček angekündigt. Die Sache Makropulos gibt es noch zweimal im April, man sollte hingehen, um mehr Janáček in unserer schönen Musikhauptstadt zu erzwingen!
Zur Sache Makropulos / Zum Anfang des Blogs
 Forderung: Jede Geigenschülerin im Laufe ihres Geigenschülerindaseins mindestens einmal zu Patricia Kopatchinskaja schicken. Nicht weil sie da die sauberste Bogenführung sähe oder hören würde, wie makellose Intonation geht oder süffiges Vibrato oder historisch korrektes Stilbewusstsein. Sondern weil sie da die Frage vor den Latz geknallt kriegte: Was ist dein Stil? Was willst du von der Musik?
Forderung: Jede Geigenschülerin im Laufe ihres Geigenschülerindaseins mindestens einmal zu Patricia Kopatchinskaja schicken. Nicht weil sie da die sauberste Bogenführung sähe oder hören würde, wie makellose Intonation geht oder süffiges Vibrato oder historisch korrektes Stilbewusstsein. Sondern weil sie da die Frage vor den Latz geknallt kriegte: Was ist dein Stil? Was willst du von der Musik?


 aufs Wunderbarste erschließt: Enescu, Bartók, Mozart.
aufs Wunderbarste erschließt: Enescu, Bartók, Mozart. Wer wäre geeigneter als Fischer, unsere Kultur geliebt zu machen?
Wer wäre geeigneter als Fischer, unsere Kultur geliebt zu machen?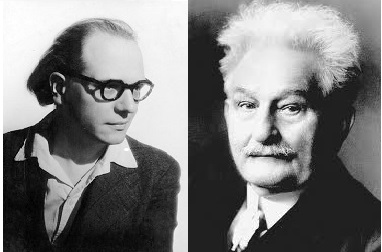 Olivier Messiaen und
Olivier Messiaen und  Iván Fischer ist der vollkommene Dirigent für alles, was wie aus der Ferne klingt, die Mitte des 1. Satzes etwa und dann natürlich die 3 Mittelsätze: In der Nachtmusik I muss der Konzertgänger, als sich die Kuhglocken zu dem wiederkehrenden echoenden Horn gesellen, vor Glück die Augen schließen. Wie Fischer anschließend das schattenhafte Scherzo in Gang zaubert – dafür nähme man das Finale in Kauf, selbst wenn es 3 Stunden dauern würde. Doch zunächst bleibt die Musik im Zauberreich, in der Nachtmusik II, einer Serenade mit Gitarre und Mandoline.
Iván Fischer ist der vollkommene Dirigent für alles, was wie aus der Ferne klingt, die Mitte des 1. Satzes etwa und dann natürlich die 3 Mittelsätze: In der Nachtmusik I muss der Konzertgänger, als sich die Kuhglocken zu dem wiederkehrenden echoenden Horn gesellen, vor Glück die Augen schließen. Wie Fischer anschließend das schattenhafte Scherzo in Gang zaubert – dafür nähme man das Finale in Kauf, selbst wenn es 3 Stunden dauern würde. Doch zunächst bleibt die Musik im Zauberreich, in der Nachtmusik II, einer Serenade mit Gitarre und Mandoline.
 n verzaubert. Konzertgängers Sohn lauscht gebannt Griegs Klavierstück Kobold, das er im Klavierunterricht übt und das
n verzaubert. Konzertgängers Sohn lauscht gebannt Griegs Klavierstück Kobold, das er im Klavierunterricht übt und das
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.