Drei, zwei, eins – keins, nevermore, nie wieder: Wiederaufnahme der Sache Makropulos von Leoš Janáček an der Deutschen Oper Berlin, noch zwei Vorstellungen gibts bis zur Derniere am 22. November. Dreieinhalb Jahre waren das seit der Premiere, ein Hundertstel der Zeitspanne, die diese Oper umspannt: ein packendes Werk über das Entsetzen der Unsterblichkeit oder, denk pink, übers Glück der Sterblichkeit.
Eigentlich aber dürfte man, bevor man reingeht, gar nichts wissen über die Handlung von Věc Makropulos. Das findet jedenfalls Michael Füting in seiner kleinen Biographie von Leoš Janáček (Transit-Verlag). Denn diese Oper von 1926 ist ja ein Thriller, der erst am Ende aufgelöst wird. Nur dass wir Heutigen, bevor wir ins Opernmuseum gehen, mittels Opernführer oder Wikipedia eigenmächtig Surprise durch Suspense ersetzen, um mit Hitchcock zu sprechen. Ob man am Ende alles durchblicken würde, wenn man sich das Stück ganz unvorbereitet anschaute? Man sollte schon ausgeschlafen sein, denn die Personenkonstellation ist verwickelt. Einen Versuch wärs aber wert, wenn man das Stück nicht kennt. In dem Fall hier nicht weiterlesen, sondern eine Karte kaufen, ohne die Inhaltsangabe zu lesen. Wer dagegen bis zum Schluss des Krimis vorblättern will (denn die Auflösung besteht in der Vorgeschichte): bitte sehr.
Eins aber ist bei Janáček ohnehin wichtiger als alle Spannung, nämlich das Mitleid. Gibt es einen menschlicheren, mitfühlenderen Opern-Autor als Janáček? Auch im Thriller wühlt er nach Empathie mit der Femme Fatale.
Die Sache Makropulos an der Deutschen Oper hat nun drei Hürden, die das Mitleiden erschweren; am Ende aber lassen sie es um so erlösender ausbrechen.
 Die erste Hürde besteht in der Inszenierung von David Hermann. Die ist kunstvoll, flüssig, schlüssig, aber macht es durch zusätzliche Verrätselungs-Ebenen dem Zuschauer nicht immer einfach. Die weibliche Hauptfigur agiert in einem Pulk von Männern, den man schwer auseinanderdröselt. Muss man aber auch nicht unbedingt, wie man bald begreift: Entscheidend ist, dass da eine Frau unter vielen Männern ist. Die warten wie beim Arzt, sagt eine Putzfrau zwischendurch. Einiger Doppelgängerinnen-Schnickschnack verstärkt nur die Alleinigkeit der Frau. Die Bühne indes ist anfangs in zwei Zeit-Ebenen unterteilt. Aber ist es nicht widersinnig, dass die leibhaftige E.M. durch die Zeiten hin und her scharwenzelt? Denn auch, wer unsterblich ist, kann ja nicht zurück in die Vergangenheit. Im Gegenteil, die Unsterbliche türmt bloß mehr und mehr Vergangenheit auf; nur dass ihr alles ganz egal wird. Ein wahrer Albtraum aber ist es, wenn sie im Jetzt den Geliebten von Ur-Einst wiedertrifft, der nun ein greiser Narr ist und die ewig Junggebliebene sofort erkennt.
Die erste Hürde besteht in der Inszenierung von David Hermann. Die ist kunstvoll, flüssig, schlüssig, aber macht es durch zusätzliche Verrätselungs-Ebenen dem Zuschauer nicht immer einfach. Die weibliche Hauptfigur agiert in einem Pulk von Männern, den man schwer auseinanderdröselt. Muss man aber auch nicht unbedingt, wie man bald begreift: Entscheidend ist, dass da eine Frau unter vielen Männern ist. Die warten wie beim Arzt, sagt eine Putzfrau zwischendurch. Einiger Doppelgängerinnen-Schnickschnack verstärkt nur die Alleinigkeit der Frau. Die Bühne indes ist anfangs in zwei Zeit-Ebenen unterteilt. Aber ist es nicht widersinnig, dass die leibhaftige E.M. durch die Zeiten hin und her scharwenzelt? Denn auch, wer unsterblich ist, kann ja nicht zurück in die Vergangenheit. Im Gegenteil, die Unsterbliche türmt bloß mehr und mehr Vergangenheit auf; nur dass ihr alles ganz egal wird. Ein wahrer Albtraum aber ist es, wenn sie im Jetzt den Geliebten von Ur-Einst wiedertrifft, der nun ein greiser Narr ist und die ewig Junggebliebene sofort erkennt.
Die zweite Hürde zum Mitleid ist Janáčeks Musik, die sich hier ja ziemlich vom vorhergehenden Schlauen Füchslein, von Katja Kabanowa oder gar Jenůfa unterscheidet: oft scharf und fast maschinenhaft getrieben, Schreckenswalzer durch die Luft wirbelnd. Der slowenische Dirigent Marko Letonja betont nicht den ja auch enthaltenen rasanten, komödiantischen Konversationston des zugrundeliegenden Theaterstücks, sondern das Unerbittliche, anfangs fast Tumultuarische. Das ist ein mitreißender, durchschüttelnder Orchesterklang. Und umso eindringlicher wirkt dann Janáčeks barmvolle Schlusswendung, beginnend, als die zuvor so schneidenden Streicher endlich, endlich weich werden und das abgrundtiefe Blech sich in einen wärmenden Untergrund verwandelt.
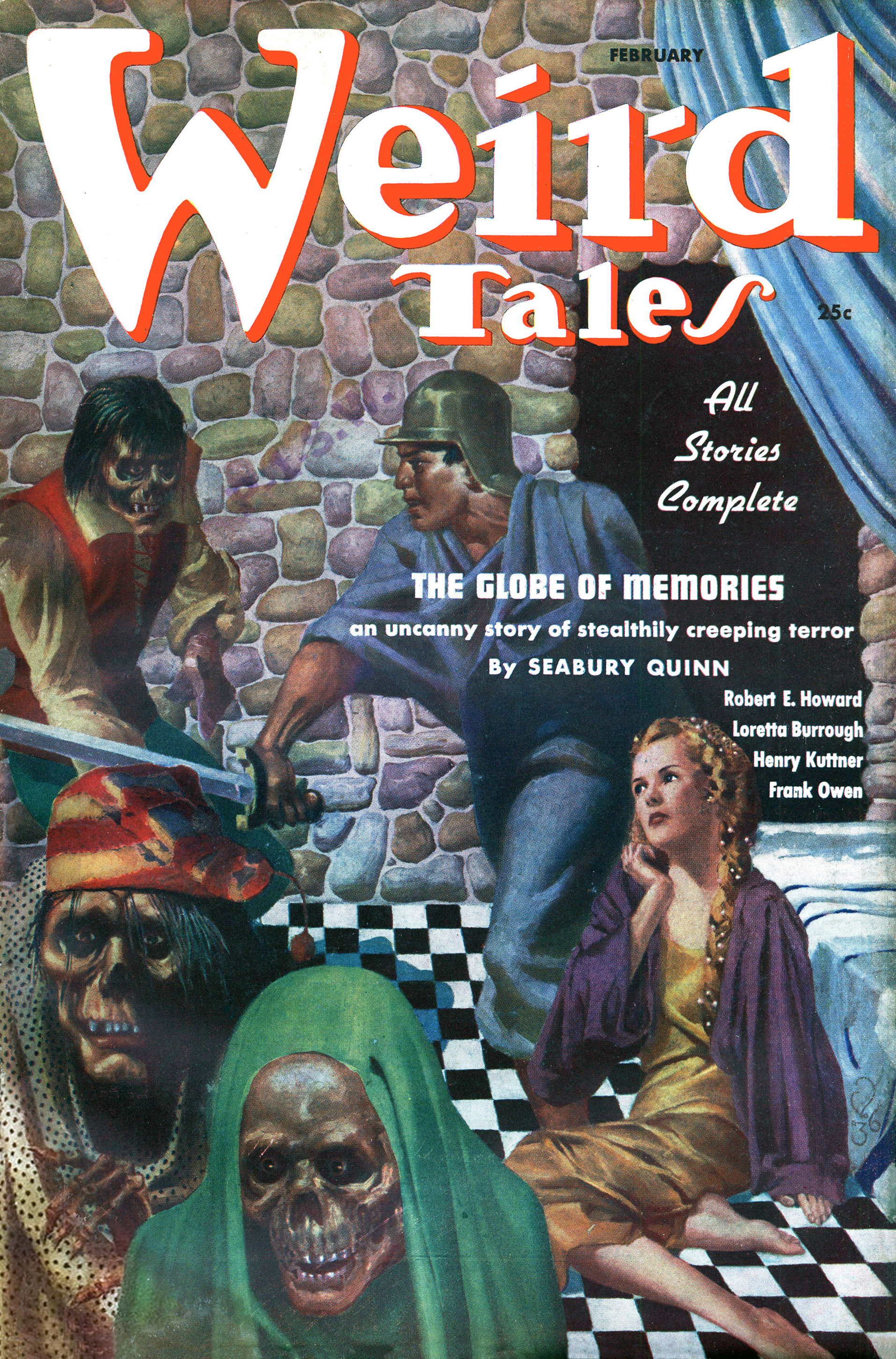 Und dann ist da die dritte und größte Hürde fürs Mitleiden, nämlich die Stimme von Evelyn Herlitzius; die ist aber zugleich der größte Trumpf dieser Aufführung. Keine vokalen Schmerz- und Schmelz-Extensions nach 337 Bühnenjahren, sondern ein scharfes, metallisches Timbre, das bei einer solchen Existenz ganz und gar am Platz ist. Der Rest des Casts ist ihr gegenüber fast unerheblich, macht aber zum Glück seine Sache durchweg gut; u.a. Aleš Briscein als Bertel Gregor, der, ohne es zu wissen, die eigene unsterbliche Ururoma begehrt. Dieses Liebesunglück nehmen wir halt so zur Kenntnis wie den Selbstmord des jungen Janek; einer von vielen. Als aber der verhärteten Unsterblichen schließlich die große Schlussweichheit begegnet, der Chor der Sterblichen, der singt: Wir sind nur Dinge und Schatten – da bricht einem Herlitzius das Herz mit ihrer Entgegnung: Wenn ihr nur wüsstet, wie leicht ihr lebt! Denn unsere Sterblichkeit ist ein Grauen und zugleich ein Glück.
Und dann ist da die dritte und größte Hürde fürs Mitleiden, nämlich die Stimme von Evelyn Herlitzius; die ist aber zugleich der größte Trumpf dieser Aufführung. Keine vokalen Schmerz- und Schmelz-Extensions nach 337 Bühnenjahren, sondern ein scharfes, metallisches Timbre, das bei einer solchen Existenz ganz und gar am Platz ist. Der Rest des Casts ist ihr gegenüber fast unerheblich, macht aber zum Glück seine Sache durchweg gut; u.a. Aleš Briscein als Bertel Gregor, der, ohne es zu wissen, die eigene unsterbliche Ururoma begehrt. Dieses Liebesunglück nehmen wir halt so zur Kenntnis wie den Selbstmord des jungen Janek; einer von vielen. Als aber der verhärteten Unsterblichen schließlich die große Schlussweichheit begegnet, der Chor der Sterblichen, der singt: Wir sind nur Dinge und Schatten – da bricht einem Herlitzius das Herz mit ihrer Entgegnung: Wenn ihr nur wüsstet, wie leicht ihr lebt! Denn unsere Sterblichkeit ist ein Grauen und zugleich ein Glück.
Weitere Kritik: Hundert11-Bericht aus dem Premierenjahr 2016. Schlatz war ebenfalls bei der Wiederaufnahme.


Oh, war ja die ganze Prominenz gestern da :-)) Ich erst am Freitag….
Na klar, alles zu Ruhm und Ehren Janaceks. Schade, dass er beim DO-Publikum nicht mehr zieht.