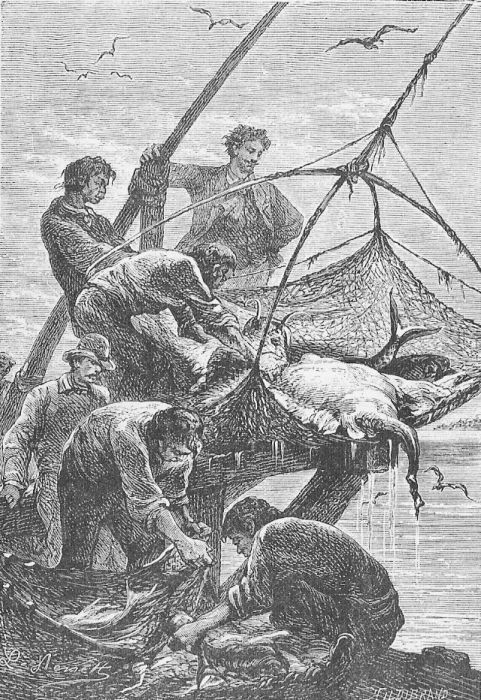 Vorspielhaft, nennt András Schiff die Arbeit des Berliner Konzerthauses und besonders des Noch-Chefdirigenten Iván Fischer. Und auch wenn er sich gleich zu beispielhaft verbessert, kann man das Wort gut stehenlassen, um die Vielseitigkeit und das lebendige Musizieren am Konzerthaus Berlin zu preisen. Den Eindruck von Schnarchmottigkeit, der das Konzerthaus-Image früher prägte, hat diese Vitalität doch ziemlich vertrieben. Mehr noch als die schnieken und preisgekrönten Social-Media-Kampagnen wie #klangberlins, die natürlich auch Nachfolger haben in der neuen Saison 2018/19 unter dem Motto Eins mit Berlin.
Vorspielhaft, nennt András Schiff die Arbeit des Berliner Konzerthauses und besonders des Noch-Chefdirigenten Iván Fischer. Und auch wenn er sich gleich zu beispielhaft verbessert, kann man das Wort gut stehenlassen, um die Vielseitigkeit und das lebendige Musizieren am Konzerthaus Berlin zu preisen. Den Eindruck von Schnarchmottigkeit, der das Konzerthaus-Image früher prägte, hat diese Vitalität doch ziemlich vertrieben. Mehr noch als die schnieken und preisgekrönten Social-Media-Kampagnen wie #klangberlins, die natürlich auch Nachfolger haben in der neuen Saison 2018/19 unter dem Motto Eins mit Berlin.
Dass es dem Konzerthaus gelungen ist, András Schiff als Artist in Residence zu gewinnen, ist natürlich ein Coup, auf den der Intendant Sebastian Nordmann bei der Saisonvorstellung sichtlich stolz ist. Von einem dicken Fisch könnte man reden, wenn nur nicht der Begriff dicker Fisch auf keinen Pianisten der Welt schlechter passte als auf diesen. Darum hier auch keine dümmlichen Wortspielchen über András Fisch und Iván Schiffer! Die Freundschaft zwischen dem Pianisten und dem Noch-Chefdirigenten stand dem Erfolg dieser Einladung sicher nicht im Weg.
 Zur Residence gehören auch drei Auftritte junger Pianisten (wohl nur zufällig ausschließlich Männer), die Schiff, der Karriere und Wettbewerb als schmutzige Wörter bezeichnet, persönlich ausgesucht hat und betreut. Heute noch kleine Fische, morgen vielleicht schon Weltstars. Und während Schiff auch bei weit über 30°C Anzug und Krawatte trägt, setzt sich Andrei Gologan bei der Saisonvorschau sogar im Dreiteiler, mit Weste unter dem Jackett, ans Klavier und gibt schon mal eine schöne Enescu-Kostprobe.
Zur Residence gehören auch drei Auftritte junger Pianisten (wohl nur zufällig ausschließlich Männer), die Schiff, der Karriere und Wettbewerb als schmutzige Wörter bezeichnet, persönlich ausgesucht hat und betreut. Heute noch kleine Fische, morgen vielleicht schon Weltstars. Und während Schiff auch bei weit über 30°C Anzug und Krawatte trägt, setzt sich Andrei Gologan bei der Saisonvorschau sogar im Dreiteiler, mit Weste unter dem Jackett, ans Klavier und gibt schon mal eine schöne Enescu-Kostprobe.
Iván Fischer wird nicht mehr Chefdirigent sein, bleibt aber fürs Publikum so präsent, als wär ers noch. Seine Schwerpunkte Strawinsky und Grüffelo ergänzen sich, muss man sagen, aufs Feinste. Das Nebeneinander von Fischer und seinem designierten Nachfolger Christoph Eschenbach vermag der Konzertgänger sich weniger leicht vorstellen; zu gegensätzlich wirken die Temperamente und das Verständnis von klassischer Musik, das die beiden verkörpern. Aber ein Grüffelo ist Eschenbach ja nun auch nicht. Von den Musikern, die mit ihm gespielt haben, hört man manches Gute, und vielleicht entpuppt der (Übergangs-)Chef sich ja als so ein Jupp Heynckes der Klassik.
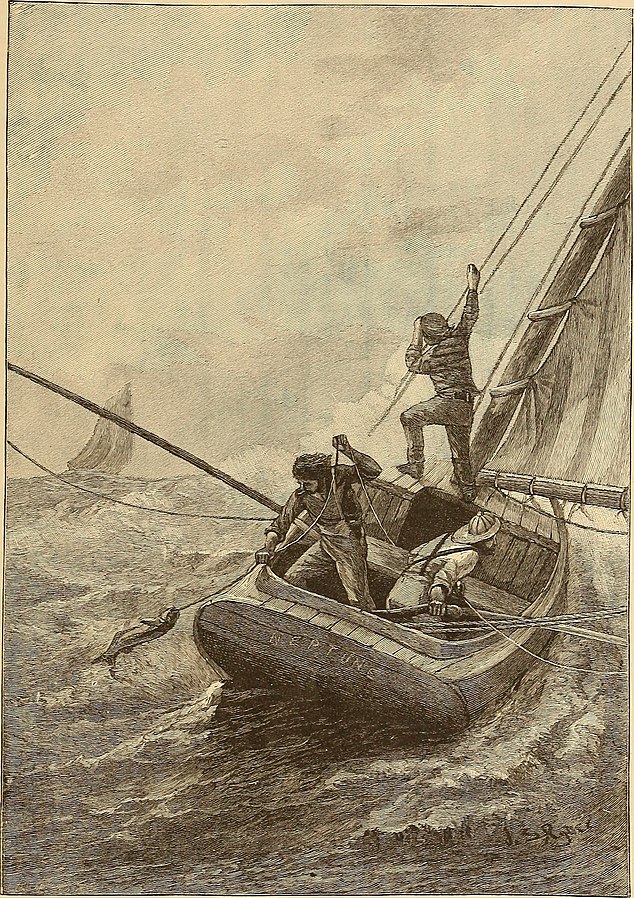 Noch viel mehr Gutes vernimmt man von Musikern des Konzerthausorchesters über Juraj Valcuha, den Ersten Gastdirigenten des Hauses, der vielleicht mal Chef werden wird. Im Programm, das Valcuha nach der Saisonvorstellung dirigiert, hört man viel, was dafür spricht.
Noch viel mehr Gutes vernimmt man von Musikern des Konzerthausorchesters über Juraj Valcuha, den Ersten Gastdirigenten des Hauses, der vielleicht mal Chef werden wird. Im Programm, das Valcuha nach der Saisonvorstellung dirigiert, hört man viel, was dafür spricht.
In drei ganz unterschiedlich temperierte künstliche Paradiese gerät man da: In Maurice Ravels Ma Mère L’Oye ist das so eine Spielapparate- und Porzellanmärchenwelt. Perfekt poliert und filigran funktionös. In Karol Szymanowskis 1. Violinkonzert dann eine schwitzend-schwülstige Hitze, die zugleich von mediterraner Klarheit scheint; das Stück ist sirrend-flirrend und transparent in einem, ein ganz eigener Ton. Sonniger Süden aus nord- und mitteleuropäischen Augen betrachtet? Nur gelegentlich meint man zwangsbildlich ältere, bleiche Großbürger diesen schmutzigen sizilianischen Bauernjungs nachjagen zu sehen, halbnackt in antike Kostümchen gesteckt. (Der Subklang dieser statuesken Wilhelm-von-Gloeden-Bilder.)
Solist Christian Tetzlaff erweist sich mit seinem muskulösen, aber nie grüffelesken Strich wieder einmal als der vollkommene Konzertgeiger.
Und er hört sich sogar nach der Pause Ottorino Respighis Fontane di Roma und Pini di Roma an. Nur die in den 1930er Jahren nachgefolgten Feste di Roma lässt man weg, wohl weil sie zu sehr nach Fasci di Roma klingen. (In der Facebook-Diskussion wird er allerdings als der modernste Satz der Trilogie eingeschätzt.)
Die Brunnen und Pinien sind nach Ravel und Szymanowski kompositorisch doch etwas subkalibrig; da beobachtet man zwischendurch ganz gern mal den coolen Tubisten, der sich in seinen Spielpausen auf den Trichter seines Instruments lehnt wie auf den Tresen. Respighis Tonband-Nachtigall aber hat hohen nostalgischen Reiz. In der monumentalmarmorierten Schlusssteigerung wartet man ein bisschen drauf, dass gleich der Duce auf der Orgelempore erscheint und sich huldvoll am römischen Gemächt kratzt.
Aber wie Valcuha auch in diesem imperisch-infernalischen Schlussdonnerwetter Ordnung und Klangmaß hält, das beeindruckt immens. Zuvor scheint er dankenswert ökonomisch manches Dreifach-Fortissimo entschärft zu haben. Scheint eine der löblichen Aufführungen zu sein, in denen ein Werk besser klingt als es komponiert wurde. Bei Ravel und Szymanowski aber imponierte die Durchgestaltung ohne Vorbehalt. Toll und nicht unwichtig gerade im Großen Saal des Konzerthauses, wie passgenau bis ins Millidezibel Valcuha die Musik in diesen Raum einfügt. Wie sich das in zwei Wochen bei Webern und Brahms bewährt, wird interessant.
Zwei weitere Aufführungen am 1. und 2. Juni.
Zur neuen Saison / Zum Valcuha-Konzert / Mehr über den Autor / Zum Anfang des Blogs

