 Die Kleinen bringen das Größte: Der Freiburger BarockConsort, die feine Kammer-Combo des Freiburger Barockorchesters, führt Claudio Monteverdis Vespro della Beata Vergine (Marienvesper) auf — das prächtigste, nuancierteste musikalische Mosaik, das jemals komponiert worden war. Mit diesem Superlativ bezieht John Eliot Gardiner sich zwar aufs Entstehungsjahr 1610, aber wer die Marienvesper heute hört, wird kaum zögern, diesem Satz auch die paar Jahre bis jetzt gutzuschreiben.
Die Kleinen bringen das Größte: Der Freiburger BarockConsort, die feine Kammer-Combo des Freiburger Barockorchesters, führt Claudio Monteverdis Vespro della Beata Vergine (Marienvesper) auf — das prächtigste, nuancierteste musikalische Mosaik, das jemals komponiert worden war. Mit diesem Superlativ bezieht John Eliot Gardiner sich zwar aufs Entstehungsjahr 1610, aber wer die Marienvesper heute hört, wird kaum zögern, diesem Satz auch die paar Jahre bis jetzt gutzuschreiben.
Die Aufführung im Kammermusiksaal leitet aus dem 13köpfigen Chor, der belgischen Vox Luminis, heraus der Bass Lionel Meunier. An seinem 36. Geburtstag und einen Tag vor dem 450. Geburtstag von Claudio Monteverdi. Sehr schön, wie die dreizehn sehr unterschiedlichen Organe prägnant hervortreten, dann wieder zu einer einzigen Stimme verschmelzen. Und umgekehrt. Dieses Wechselspiel ist Programm: Alles scheint schon im ersten Abschnitt angelegt, den die Stimmen auf drei gleichbleibenden Tönen deklamieren, die einen stehenden Akkord ergeben — bis sie sich im abschließenden Alleluia melodisch verflüssigen. Im Duo Seraphim singen zunächst, logisch, zwei Stimmen, bevor zur Bezeugung der Trinität (tres sunt) eine dritte Stimme hinzutritt, die sich schließlich mit den ersten beiden (unum sunt) auf vollkommene Weise vereint.
Atemberaubend, das hörend so deutlich nachvollziehen zu können. Die Marienvesper ist ja wirklich eine veritable Oper, wie Gardiner schreibt! Die individuellen Stimmen becircen zwar nicht gleichermaßen (ein Sopran klingt zunächst etwas belegt, ein Tenor quetscht). Ausgerechnet der Tenor Raffaele Giordani, der nicht im Programmheft auftaucht, begeistert am stärksten — neben Meunier, der sein Ensemble auch mit vokaler Wucht vorantreibt. Gerade die Frauenstimmen müssten manchmal (etwa im Dixit Dominus oder zu zweit im Pulchra es) nicht gar so zurückhaltend sein. Aber wie der Chor aufeinander einschwingt, lauscht, reagiert, sich immer wieder ineinander umschichtet und verschiebt, das ist schon sehr fein.
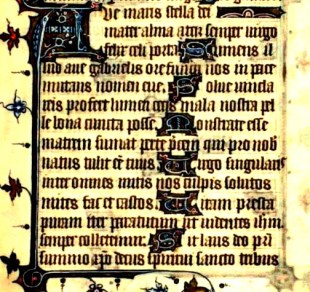 Der feine BarockConsort besteht ohnehin aus lauter erstrangigen Instrumentalisten. An der Laute mal nicht Altrocker Lee Santana, sondern Andreas Arend, der mit seinem Wuschelkopf mehr von einem Softrocker hat. In der Sonata und dem Hymnus Ave maris stella haut einen die Brillanz der 14 Musiker, zumal der Bläser, fast vom Klappstuhl. Wunderbar lässt sich jede Linie, jede Verzweigung, jede Ader verfolgen.
Der feine BarockConsort besteht ohnehin aus lauter erstrangigen Instrumentalisten. An der Laute mal nicht Altrocker Lee Santana, sondern Andreas Arend, der mit seinem Wuschelkopf mehr von einem Softrocker hat. In der Sonata und dem Hymnus Ave maris stella haut einen die Brillanz der 14 Musiker, zumal der Bläser, fast vom Klappstuhl. Wunderbar lässt sich jede Linie, jede Verzweigung, jede Ader verfolgen.
Man muss allerdings sehr genau hinhören, denn der Kammermusiksaal ist trotz seines irreführenden Namens nun mal ziemlich groß und vor allem hoch. Den mitreißenden Walking Bass im Laetatus sum etwa hat die Lauttencompagney auf ihrer Marienvesper-CD mit einem Dulzian (der Oma des Fagotts) verstärkt, so dass er in dieser Aufnahme fast nach Berlioz‘ Symphonie fantastique klingt. Beim BarockConsort stapft James Munros Violone (der Opa des Kontrabasses) wacker allein auf und ab. Das klingt sehr fein, aber eben auch … sehr fein.
Ein wenig gilt das für die ganze Aufführung: Sie zeigt mustergültig, wie kunstvoll und abwechslungsreich diese Musik ist, sie berührt auch, durchaus, aber sie überwältigt nicht. Man stellt sich vor, wie berauschend einem im Kirchenhall die Mehrchörigkeit um die Ohren pfiffe. Diese doch wichtige Dimension fehlt hier eben. Selbst wenn man, wie der Konzertgänger, sehr weit oben im hohen Kammermusiksaal sitzt, wo irgendwo von rechts ein bizarres Flatterecho kommt, das bei einem Klavierrezital sehr störend wäre, aber bei dieser Sakralmusik gar nicht so unwillkommen ist.
Als stünde man vor einem Kirchenportal und hörte eine phänomenale Aufführung der Marienvesper von draußen.

Dass die Raumdimension fehlt, macht sich auch bei den Echos im Audi coelum bemerkbar, die einfach durch die Tür hinter dem Podium kommen. Das klingt doch unbefriedigend (obwohl die feinohrige Nachbarin des Konzertgängers bemerkt, es klinge wie ein echtes Echo: zu tief). Vielleicht ließe sich sowas doch besser von einer Tür auf der Empore singen? Im abschließenden Magnificat dreht der Echo-Tenor sich einfach um, das ist viel besser. Zumindest für den Teil des Publikums, der vor der Bühne sitzt; dahinter muss es ja ganz seltsam tönen.
Ein Wermutstropfen angeohrs dieses vollkommen ausgewogenen Singens und Spielens. Wie aber die Musik in jeder Schlussformel sich anspannt, wie das Amen des Hymnus aufs große Magnificat hin anschwillt, wie im Schlussteil auf einmal zwei nie gehörte Flöten erklingen: das ist dann ohne jeden Raum-Effekt, ganz aus sich, von betörender Transzendenz.

Jaja, Gardiner hat recht, ein grandioses Werk