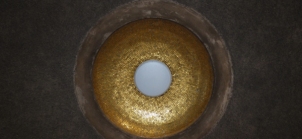 Mittags Rodeln, abends Schönberg. Tagsüber ruft der Schnee in den Park, am Abend Spectrum Concerts in den Kammermusiksaal. Das ist die interessanteste, vielfältigste, immer hochklassige, kurzum: wohl beste Kammermusikreihe, die es in Berlin gibt. Nur Star-Appeal fehlt meistens, so dass der Saal manchmal halbleer ist und die Reihe seit Jahren immer mal wieder ums Überleben kämpft.
Mittags Rodeln, abends Schönberg. Tagsüber ruft der Schnee in den Park, am Abend Spectrum Concerts in den Kammermusiksaal. Das ist die interessanteste, vielfältigste, immer hochklassige, kurzum: wohl beste Kammermusikreihe, die es in Berlin gibt. Nur Star-Appeal fehlt meistens, so dass der Saal manchmal halbleer ist und die Reihe seit Jahren immer mal wieder ums Überleben kämpft.
An diesem Abend ist jedoch ein Star dabei, darum ist der Saal nicht halbleer, sondern halbvoll: die niederländische Geigerin Janine Jansen, die Spectrum als ihre kammermusikalische Heimat bezeichnet. Unter den sechs Musikern des Abends ragt sie jedoch in keiner Weise heraus – was für Jansens kammermusikalischen Spirit spricht, aber natürlich auch für die Qualität der anderen.
Neben Jansen (im eleganten schulterfreien schwarzen Abendkleid) und der spanischen Flötistin Clara Andrada de la Calle (attraktiver schwarzer Hosenanzug mit irisierender Glitzerbluse) spielen vier Männer: der russische Geiger Boris Brovtsyn (schwarzes Hemd), der schwedische Cellist Torleif Thedéen (schwarzes Jackett), der französische Klarinettist Olivier Patey (schwarzes Jackett) und der russische Pianist Eldar Nebolsin (schwarzes Jackett). Kammermusik ohne Frauen ist Mist, rein optisch gesehen.
 Vor den Wiener Neutönern gibt es den Wiener Wohltöner Erich Wolfgang Korngold. Aber was heißt schon wohltönend bei einem Werk, das vom ersten Moment so intensiv und dringlich klingt wie die Suite für 2 Violinen, Cello und Klavier linke Hand op. 23 (1930)?
Vor den Wiener Neutönern gibt es den Wiener Wohltöner Erich Wolfgang Korngold. Aber was heißt schon wohltönend bei einem Werk, das vom ersten Moment so intensiv und dringlich klingt wie die Suite für 2 Violinen, Cello und Klavier linke Hand op. 23 (1930)?
Das Werk entstand, wie fast alles für die Linke (darunter Ravels Konzert), im Auftrag des Pianisten Paul Wittgenstein, der im I. Weltkrieg seine rechte Hand verloren hatte. Nebolsin schummelt etwas, er benutzt sehr wohl die Rechte. Allerdings nur zum Umblättern.
Mächtig laut, ja angeberisch und mit Pedal satt setzt das Klavier ein. Da müssen die drei Streicher erstmal gegen ankommen, was ihnen zunächst und auch später immer wieder nur unisono gelingt. Um so zarter tönen die lyrischen Inseln, wenn die Stimmen einzeln singen: Thedéen mystisch gedämpft, Jansen brillant, Brovtsyns Ton ist spröder, vielleicht noch vielschichtiger. Aber man muss hier nichts gegeneinander abwägen, denn bravourös ist vor allem das Miteinander: Jeder Einsatz, jedes Zwiegespräch zeugt von blindem Verständnis, klingt so eingespielt und ausgefeilt, als übten die vier seit Jahren täglich zusammen.
Ein bodenloser Walzer folgt, dann eine Scherzo-Groteske wie eine Verfolgungsjagd. Im wahrhaft korngoldesken, d.h. exzessiv innigen Lied überwältigt Jansens leuchtender Ton. In einer Orchesterfassung klänge das vermutlich unerträglich, in Kammerbesetzung ist es himmlisch. Wie das verblüffend komplexe Finale, halb Rondo, halb Variationensatz.
 Nach der Pause zweimal Wiener Schule. Das Adagio aus seinem Kammerkonzert (1925) hat Alban Berg selbst für Violine, Klarinette und Klavier eingerichtet: ein Stück mit eingebautem Ratespiel für das Kind im fortschrittlichen Manne (und in der avantgardistischen Frau), ab der Mitte läuft es spiegelverkehrt zum Anfang zurück. Das kommt einem, wie die eingebauten Namens-Anagramme, wie kompositorisches Pillepalle vor, oder wie ein Mittel zum Zweck. Der Zweck nämlich: überirdisch, wie die drei Instrumente ineinander verwoben scheinen, Jansens auch dicht vor der Unhörbarkeit singende Geige aus Nebolsins warmem Anschlag hervorzugehen scheint, Pateys wie aus sich selbst atmende Klarinette aus dem Geigenton.
Nach der Pause zweimal Wiener Schule. Das Adagio aus seinem Kammerkonzert (1925) hat Alban Berg selbst für Violine, Klarinette und Klavier eingerichtet: ein Stück mit eingebautem Ratespiel für das Kind im fortschrittlichen Manne (und in der avantgardistischen Frau), ab der Mitte läuft es spiegelverkehrt zum Anfang zurück. Das kommt einem, wie die eingebauten Namens-Anagramme, wie kompositorisches Pillepalle vor, oder wie ein Mittel zum Zweck. Der Zweck nämlich: überirdisch, wie die drei Instrumente ineinander verwoben scheinen, Jansens auch dicht vor der Unhörbarkeit singende Geige aus Nebolsins warmem Anschlag hervorzugehen scheint, Pateys wie aus sich selbst atmende Klarinette aus dem Geigenton.
Kammermusik in Vollendung.
 Das Gleiche gilt für die Aufführung von Weberns 1922/23 entstandener reduzierter Version von Arnold Schönbergs 1. Kammersinfonie op. 9 (1907), für 5 statt 15 Musiker. Die berühmt-berüchtigte Quarten-Fanfare (die Fanfare der Neuen Musik) des noch frei tonalen Stücks spielt kein Horn, sondern das Cello. Noch deutlicher als im Original wird das brahmshaft vertrackte Voranschreiten des Ganzen. Schönberg hat ja später Brahms‘ g-Moll-Klavierquartett orchestriert, was (mit Verlaub) furchtbar klingt – umgekehrt hätte er’s machen sollen, aus Brahms‘ Sinfonien Quartette!
Das Gleiche gilt für die Aufführung von Weberns 1922/23 entstandener reduzierter Version von Arnold Schönbergs 1. Kammersinfonie op. 9 (1907), für 5 statt 15 Musiker. Die berühmt-berüchtigte Quarten-Fanfare (die Fanfare der Neuen Musik) des noch frei tonalen Stücks spielt kein Horn, sondern das Cello. Noch deutlicher als im Original wird das brahmshaft vertrackte Voranschreiten des Ganzen. Schönberg hat ja später Brahms‘ g-Moll-Klavierquartett orchestriert, was (mit Verlaub) furchtbar klingt – umgekehrt hätte er’s machen sollen, aus Brahms‘ Sinfonien Quartette!
Bei Schönbergs eigener verkammerter Kammersinfonie ist alles da, was eine klassisch-romantische Sinfonie braucht. Zugleich ist sie ein avantgardistisches Wimmelbild, dessen Logik sich emotional erschließt. Geradezu physisch spürt man die ungeheure kompositorische Dichte, auch wenn man nur wenig (erst recht nicht die, laut Berg, 19 Themen) intellektuell erfasst.
Doch nicht nur das. Zugleich können die fünf grandiosen Musiker nämlich einen atemberaubend fetten Orchestersound herstellen. Hörte ein musikalischer Finanzpolitiker das, könnte er auf die fatale Idee kommen, dass fünf Musiker für eine Symphonie doch ausreichen. In gewisser Weise hätte er da nicht mal Unrecht. Es ist aber kein Argument für die Einsparung von Symphonieorchestern, sondern für mehr Kammermusik.
Spectrum gibt’s wieder am 30. März, mit Schumann und Brahms und dem Ex-Philharmoniker Guy Braunstein neu an Bord.
Weitere Kritiken: Kulturradio, Tagesspiegel
